– und was das mit Bildung und Politik zu tun hat
Harald Welzer lädt uns ein, das eigene Innenleben wie ein Haus zu betreten.
Hier gibt es den Artiikel als PDF: Haus der Gefühle_#3_2025
Ein Haus mit vielen Zimmern: hellen, belebten, aber auch zugigen, vergessenen, verschlossenen. Dort wohnen unsere Gefühle – Freude, Vertrauen, Neugier, aber auch Angst, Wut oder Scham. Dieses Haus ist kein Zufallsbau. Es entsteht aus Herkunft, Beziehung, Erinnerung – aus dem, was uns geprägt hat und was wir weitergeben.
Welzer beschreibt, wie brüchig viele dieser inneren Häuser geworden sind. Zu viel Tempo, zu viele Krisen, zu wenig Resonanz.
Wenn Menschen sich entfremden, verlieren sie das Gefühl von Geborgenheit – im eigenen Leben wie in der Gesellschaft. Dann, sagt Welzer, ziehen andere ein: Angst, Misstrauen, Spaltung. Populist:innen nutzen die Risse im emotionalen Mauerwerk, um ihre Stimmen dort laut werden zu lassen.
Doch das Buch ist keine Klage, sondern ein Umbauplan.
Welzer zeigt, wie Gefühle, Beziehungen und Bildung zusammengehören. Vertrauen, Empathie und Zuversicht sind keine Privatsache – sie sind das emotionale Fundament von Demokratie und Zukunftsfähigkeit. Eine Gesellschaft, deren Mitglieder den eigenen Gefühlen nicht trauen, ist anfällig für Vereinfachung, Manipulation und Angstpolitik. Demokratie, so Welzer, ist ein emotional anspruchsvolles Projekt – sie braucht Menschen, die Ambivalenzen aushalten, sich berühren lassen, Mitgefühl empfinden und Verantwortung übernehmen.
Und genau dort beginnt Pädagogik.
Denn wer mit Kindern arbeitet, weiß: Sie wohnen noch ganz selbstverständlich in ihren Gefühlen.
Sie staunen, lachen, weinen, fragen – manchmal alles gleichzeitig. Ihr inneres Haus ist offen, voller Türen und Fenster. Erwachsene, sagt Welzer zwischen den Zeilen, haben oft vergessen, wie man dort wohnt.
Bildung aber – echte Bildung – heißt, Kinder in ihrem Gefühlshaus zu begleiten, statt ihnen früh beizubringen, es zu verriegeln. Im Kontext von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) gewinnt dieser Gedanke neue Kraft:
Wie sollen Kinder Mitgefühl für die Welt entwickeln, wenn sie es nicht erst für sich selbst und füreinander erfahren?
Wie sollen sie Verantwortung übernehmen, wenn ihr inneres Fundament aus Unsicherheit besteht?
Welzer zeigt, dass Zukunft nicht allein durch Wissen entsteht, sondern durch emotionale Stabilität, Beziehung und Sinn.
Und damit ist „Das Haus der Gefühle“ auch ein zutiefst politisches Buch. Es erinnert daran, dass gesellschaftlicher Wandel nicht nur in Gesetzen oder Strukturen beginnt, sondern in der Art, wie Menschen fühlen, zuhören, miteinander sprechen.
Bildung, die das fördert – die Kinder und Erwachsene befähigt, die eigenen Emotionen wahrzunehmen und die der anderen zu respektieren –, wird zur Schule der Demokratie. Denn Empathie ist politisch. Vertrauen ist politisch. Staunen ist politisch.
Vielleicht braucht nachhaltige Bildung weniger neue Programme – und mehr Räume, in denen Kinder sich sicher, gesehen und verbunden fühlen. Räume, in denen man miteinander lacht, zweifelt, zuhört, staunt.
So entsteht Resilienz – in Menschen, in Teams, in Gesellschaften.
Das Haus der Gefühle ist damit auch ein Buch über Kitas, Horte, Schulen – über Orte, an denen täglich gebaut wird: an Vertrauen, Zugehörigkeit, Mut.
Denn Zukunft, sagt Welzer, braucht Herkunft – und Herkunft beginnt im Gefühl.
Und nur, wer die eigenen Gefühle kennt, kann sich nicht so leicht in die Angsthäuser anderer einmieten lassen.#

Harald Welzer
Das Haus der Gefühle
Warum Zukunft Herkunft braucht
S.Fischer 2025
304 Seiten, 25,– Euro
 Vorheriger Artikel
Vorheriger Artikel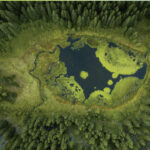 Nächster Artikel
Nächster Artikel