Hier gibts den Artikel als PDF: kitaqualitaetsentwicklung_#1_2021
… oder welche Richtung nimmt die Kita-Qualitätsentwicklung?
Über Kita-Qualität, wie man sie misst und verbessert, debattieren Experten und Wissenschaftlerinnen, verfassen Empfehlungen, Gutachten und Stellungsnahmen.1
In einer wamiki-Gesprächsrunde melden sich Frauke Hildebrandt, Yvonne Quittkat und Marie Sander zu Wort – durch die Pandemie zwar belastet, aber an der kritischen Auseinandersetzung interessiert.
wamiki: Um freundlich zu beginnen: Welche positiven Aspekte zeigen sich in der Debatte?
Yvonne Quittkat: Positiv ist auf jeden Fall, dass empfohlen wurde, den Fachkraft-Kind-Schlüssel weiter zu verbessern. Das ist zwar nichts Neues, wird seit Jahren debattiert, aber immerhin wird es wieder benannt. Positiv fand ich auch, dass es mehr, konkretere und verbindliche Vor- und Nachbereitungszeiten und Verbesserungen in der Aus- und Weiterbildung geben soll.
Marie Sander: Da sind wir uns einig. Aufregender ist natürlich, was wir nicht in Ordnung fanden. Zum Beispiel den Blick auf Kinder und Bildung, den defizitorientierten Blick auf Kindheit. Davon verabschieden wir uns ja immer noch mühsam und freuen uns, wenn wir das schaffen.
Im Netzwerk Offene Arbeit Berlin/Brandenburg hatten wir uns letztens darüber ausgetauscht, was Kinder brauchen: freie Zeit, freien Raum und die Möglichkeit, aus dem getakteten und kontrollierten Kita-Alltag auszusteigen. Das ist absolut wichtig für Kinder, aber manches in den Empfehlungen läuft genau in die andere Richtung, scheint mir.
Yvonne Quittkat: Ich mache mir Sorgen, dass das, was jetzt womöglich an Diagnoseinstrumenten, Beobachtungs- und Screeningverfahren vorgeschlagen wird, letztlich dazu dient, Kinder und ihre Entwicklung wieder abrechenbar zu machen. Dass Fachkräfte die Chance haben, darüber nachzudenken, wie und warum sie was für ein Kind tun, geben diese Instrumente wahrscheinlich nicht her.
Frauke Hildebrandt: Wenn ich es richtig verstanden habe, will der Senat einen besseren Überblick über die Qualität in den Berliner Einrichtungen bekommen, weil er mit der Qualitätsentwicklung nicht zufrieden ist und sie beschleunigen will. Dieses Anliegen finde ich vernünftig. Aber wie kann man es umsetzen? Man kann versuchen, irgendwie messbar zu machen, was in den Kitas passiert. Gerade wird diskutiert, wie das auf der Kind-Ebene möglich ist.
Alle sagen: Wir wollen die Qualität in den Kitas verbessern. Aber was ist denn Qualität? Und wer sagt etwas darüber aus? Wenn es ganz schlimm kommt, bezieht man sich auf einen Eltern-Fragebogen, in dem die Eltern ankreuzen, wie zufrieden sie sind. Oder man bezieht sich auf die Erzieherinnen, was ich vernünftig finde, und sagt: Wenn sie gut handeln, dann haben wir Qualität. Aber niemand fragt: Was ist das jetzt wirklich für die Kinder? Viele denken: Wenn wir rauskriegen wollen, ob eine Kita gut ist oder nicht, müssen wir auf die Kinder gucken.

wamiki: Worauf guckt man dann? Auf Kompetenzen und Interessen von Kindern?
Frauke Hildebrandt: Kompetenzen und Interessen von Kindern systematisch zu erfassen – das ist zwar gut gemeint, geht aber nach hinten los, weil es den Blick pädagogischer Fachkräfte auf die Kinder automatisch verändert, ihn immer verstellt. Das sehen wir an der Schule, wo solche Kompetenzmessungen oder die individuellen Lernstandsanalysen in Brandenburg den Fachkräften eigentlich nur Aufschluss darüber geben sollen, wo welches Kind steht und wie sie es unterstützen können. De facto wirkt das aber wie eine Messlatte, die an die Kinder gelegt wird. Man denkt leider immer, obwohl man das nicht müsste: Wenn wir messen, wie etwas ist, folgt daraus, dass wir alle Kinder gleichschrittig auf das angestrebte Ziel zubewegen können.
Nun könnte ein Kita-Team sagen: Okay, lass sie doch in Gottes Namen messen, was sie wollen. Wir machen unsere individuelle Pädagogik. Doch dazu muss man robust sein und widerständig. Das sind nicht viele. Die meisten reichen den Stress an die Kinder weiter, statt ihren Stiefel durchzuziehen, Messergebnisse nur als Informationen über ein Kind zu nutzen und sich zu überlegen, wie sie dieses Kind unterstützen können. Das ist zwar eigentlich die Idee. Sie funktioniert aber nicht, glaube ich und finde, man sollte die Finger davon lassen, Kompetenzen der Kinder systematisch zu erfassen – egal, in welchem Bereich. Und wenn man es doch machen will, muss man alles tun, um diesen drastischen Kollateralschaden zu vermeiden.
Marie Sander: Mich erinnert das an den grünen Sprachstands-Bogen, der jetzt auch in der Kritik steht: Da mussten wir an den Zahlen drehen, um den Förderbedarf rauszukriegen. Das heißt: Kinder, die mehr Förderung brauchen, hatten eigentlich viel zu gute Ergebnisse. Solche Zahlen sind also Quatsch, und solche Testergebnisse sind hinfällig.
Es erinnert mich auch an QUAKI2. Da ging es um Qualität aus Kindersicht. Das fand ich schwierig und merkte, als ich las, was ein Literat über seine Kindheit im Kindergarten schrieb, warum. Er kam aus einem schlechten Kindergarten in einen für ihn besseren und stellte fest: Kita muss gar nicht so sein, wie ich es erlebt hatte, sie kann auch anders sein. Das wissen Kinder, die immer in den gleichen Kindergarten gehen, aber nicht.
Im NOA3 hatten wir das übrigens ausprobiert, uns allerlei Fragen ausgedacht, und waren gescheitert. Es hatte zwar Spaß gemacht, weil es interessant war, was Kinder so über ihre Kita erzählen, aber unsere Schlussfolgerung war: Was bei QUAKI herauskommt, ist manipuliert, denn: Wer stellt die Fragen? Wer interpretiert die Antworten? Was hat derjenige für eine Vorstellung von Qualität?
Trotzdem kam heraus, was für Kinder – aus der Interpretation Erwachsener – wichtig ist: Freiraum, Geheimnisse haben dürfen, mit Freunden zusammen sein. Das zeigt übrigens auch Corona: Kinder sind das Wichtigste für Kinder.
Yvonne Quittkat: Außerdem: Wenn wir Kinder an ihren Kompetenzen messen, hat es keine Auswirkungen darauf, ob sich verändert, wie Fachkräfte mit Kindern umgehen.
Frauke Hildebrandt: Im schlimmsten Fall verändert es sich in eine negative Richtung.
Yvonne Quittkat: Als Fachberaterin will ich natürlich Weiterentwicklung ermöglichen und dazu beitragen, dass pädagogische Fachkräfte ihren Umgang mit Kindern verändern und überlegen, was dem jeweiligen Kind gut tut. Bei QUAKI ist das schwierig, obwohl die Idee, Kinder zu befragen, gut ist. Aber was macht man damit? Wie geht man mit den Antworten der Kinder um?
Frauke Hildebrandt: Darüber könnte man 100 Jahre diskutieren. Dann zieht man immer die Schlussfolgerungen, die passen und von den Kinder inspiriert sind, die sowieso immer aktiv dabei sind. Was nicht passt, wird weggelassen, und es folgt nichts daraus. Trotzdem glaube ich, dass man die Kinderperspektive auf Qualität in Kitas einfangen kann und dass es sinnvoll ist, daraus Schlussfolgerungen zu ziehen.
Aber nochmal zur Qualitätsdiskussion generell: In Brandenburg gibt es Leute, die sagen: Uns reicht das Geschwafel über Selbstbildungsprozesse von Kindern und Selbstfindungsprozesse pädagogischer Profis. Immer fallen Kinder aus besonders bildungsbenachteiligten Familien hinten runter, wenn Selbstbildungsprozesse im Vordergrund stehen. Auf diese Kinder guckt niemand. Man möchte die bildungsbenachteiligten Kinder besser fördern und findet es nötig, dass pädagogische Fachkräfte regelmäßig auf bestimmte Dinge achten und dafür sorgen, dass die Kinder Anregungen kriegen, geregelt und alle zusammen. Man argumentiert nicht aus einer kapitalistischen Wirtschaftslogik, sondern möchte, dass die Kinder, die hinten runterfallen, wenn es um Partizipationsprozesse und ähnliches geht, im Blick bleiben. Und man möchte wissen, was bei den Kindern am Ende ankommt. Wenn das dazu führt, dass bestimmte Beschäftigungen immer wieder stattfinden, dann müsse das sein, damit diese Kinder erreicht werden. Es sei eine wohlfeile, bildungsbürgerliche Idee, jedem Kind seinen Spielraum zu gewähren und dabei hinzunehmen, dass manche Kinder überhaupt nichts lernen. Ich finde, man muss diese Argumentation und das soziale Anliegen, dem sie entspringt, auf jeden Fall ernst nehmen.
Marie Sander: Der Alltag der Kitas, die ich kenne, zeigt aber: Wir müssen in die andere Richtung rudern. Es gibt immer noch zu viel Vereinheitlichung und Angebote für alle. Das, was die Brandenburger Leute fordern, gibt es noch so häufig, dass ich der Meinung bin: Wir müssen unsere Kräfte in die Gegenrichtung investieren.
wamiki: Du sprichst aus der Perspektive einer Kita-Leiterin. Politisches Handeln betrifft eine andere Ebene. Außerdem traut ihr euch – du und dein Team – etwas Vorgegebenes nicht zu tun, weil es nicht zu eurer Kita, euren Kindern, eurem Konzept passt. Und ihr könnt das begründen.
Yvonne Quittkat: Das beschäftigt mich immer wieder: Wie kommen pädagogische Fachkräfte dahin, ihr Handeln begründen zu können: Ich mache das so, weil…
Und: Was kann ein Kind jetzt an Unterstützung gebrauchen? Wie können Pädagoginnen das herausfinden? Im Umkehrschluss: Die Kompetenzabrechnung ist ja immer nur ein Ergebnis, sie sagt nichts über den Prozess.

wamiki: Über den Weg des Kompetenzerwerbs?
Yvonne Quittkat: Ja. In Berlin wird jetzt eine Tool-Box zu Mathe und Sprache entwickelt, die es Pädagoginnen erleichtern soll, Angebote zu machen. Da gruselt mich schon das Wort „Angebote“.
Andererseits: Es gibt noch zu viele Kinder, die hinten runterfallen, und es ist wichtig, das zu benennen. Dennoch frage ich mich: Ermöglicht eine Tool-Box, dass weniger Kinder aus dem Blick geraten?
Marie Sander: Mein Mann und meine Tochter arbeiten in der Schule. Beide sagen: Wenn man in den ersten Schuljahren mehr Zeit für den Erwerb mathematischer und sprachlicher Grundkompetenzen aufwenden würde, dann würde sich für viele Kinder die Möglichkeit ergeben, auch in anderen Bereichen kompetenter zu werden. Deshalb finde ich das, was die Brandenburger Leute sagen, doch bedenkenswert. Zwar bin ich mehr für die vielseitig gebildete Persönlichkeit, allseitig habe ich mir abgeschminkt, aber es könnte es ja sein, dass ein Fokus zu einer bestimmten Zeit später bessere Zugänge ermöglicht.
Frauke Hildebrandt: Wer weiß? In allen Bildungsprogrammen ist von kokonstruktivem Lernen und gemeinsam geteiltem Denken die Rede. Aus diesen Programmen schließt man höheren Ortes dann auf die Wirklichkeit und denkt: Wenn die Wirklichkeit nicht die Ergebnisse bringt, die wir wollen, liegt es sicher daran, dass die pädagogischen Fachkräfte machen, was in den Programmen steht. Das stimmt aber leider nicht. Diese guten Ideen sind noch nicht in der Breite umgesetzt. Trotzdem gibt es die Vorstellung: Wir haben das lange so gemacht – jetzt müssen wir das Ruder mal rumreißen. Und das gerade zu einem Zeitpunkt, an dem es vielleicht doch mal in die richtige Richtung gehen könnte. Fatal!
In den Kita-Konzeptionen steht ja genau das Gleiche wie in den Plänen. Wie man Papiere schreiben muss, hat man gelernt. Und dann denken die Leute natürlich, dass in den Kitas so gearbeitet wird. Dadurch entsteht eine schwierige Gemengelage, die nach außen hin schwer erklärbar ist.
Yvonne Quittkat: Ich sehe auch, dass da noch keine Verstetigung stattgefunden hat. Seit Jahren versuchen wir, miteinander zu klären, was Partizipation von Kindern ist, wie Erzieherinnen Dialoge mit Kindern führen können und wie man mit einem Beobachtungsinstrument wie dem Sprachlerntagebuch herausfinden kann: Was ist gerade los? Was erlebt ein Kind gerade? Aber das ist längst noch nicht allgemeine Praxis. Da müssen wir Fachwissen zur Verfügung stellen, statt das Rad zurückzudrehen und Häkchen zu setzen: Kann das Kind, kann das Kind nicht.
wamiki: Es ist also unsinnig, etwas Alt-Neues aus dem Boden zu stampfen, das letztlich nicht in der Praxis ankommt oder mit ihr wenig zu tun hat. Sinnvoller ist es vielleicht, die positiven Ansatzpunkte, die es gibt, auszubauen und zu festigen.
Yvonne Quittkat: Ja, denn ich befürchte, dass es in manchen Kita-Teams sogar sehr gut ankommt, wieder Angebote zu machen und beim Vertrauten zu bleiben.
Marie Sander: Das zeigt auch Corona. Manche Kolleginnen kamen mit dieser Freiheit a la „Lasst die Kinder erst mal machen, und dann gucken wir“ nie gut klar und finden, dass die Arbeit nicht befriedigend ist, weil man so schwer zu Ergebnissen kommt, die man abrechnen kann. Die Verregelung ist für sie ein angenehmer Nebeneffekt der Corona- Zeit: Endlich wieder mehr Ordnung, mehr Abstand, mehr Sortierung. Und alle wieder in ihren Gruppenräumen.
Frauke Hildebrandt: Im Prinzip geht es darum, nicht wieder eine neue Sau durchs Dorf zu jagen. Wir müssen thematisieren, was mancherorts schon geht: Bildungsprozesse systematisch gestalten. Wie kann man die Pädagoginnen dabei unterstützen? Wie kriegt man es hin, dass sie tun, was in den Plänen und Konzepten steht? Ich weiß es nicht.
In vielen Studien wurde zum Beispiel festgestellt, dass die Interaktionsqualität nicht mit dem Personalschlüssel korreliert. Und: Es liegt nicht an der Personal-Menge, wie partizipativ in der Kita gearbeitet wird.
Im Interesse der Kinder finde ich schon, dass die Erzieherinnen bestimmte Sachen einfach tun müssen – ob sie wollen oder nicht, ob ihre pädagogische Haltung noch von Erziehungsvorstellungen aus ihrer Kindheit geprägt ist oder nicht. Deshalb muss es klare Ansagen geben: Was geht und was geht nicht. Wie ein Standard beim TÜV, aber mit dem entsprechenden Handwerkszeug. Seien es Tool-Boxen oder etwas anderes. Doch daran fehlt es, während es alle möglichen schwammigen Normative gibt: Man soll die Kinder wertschätzen, ihnen auf Augenhöhe begegnen und so weiter. Kein Mensch weiß, was das konkret in dieser oder jener Situation bedeutet. Kurz: Ich würde nicht auf die Kinder gucken, sondern konkretere Anforderungen an die Pädagoginnen stellen.
Marie Sander: Ich habe den Eindruck, dass das reaktionär ist, was an Vorschlägen kam – abgesehen von wenigen sinnvollen. Und was wir nicht sinnvoll fanden, ist keine neue Sau, sondern eine alte, die wieder herumgejagt wird.
Wenn ich überlege, was mir hilft, die Arbeit mit den Kindern zu verbessern, dann waren das immer die Treffen im NOA, bei denen wir offen und kritisch reflektierten: Was machen wir eigentlich? Warum machen wir das? Wie macht ihr das? Danach konnte ich besser arbeiten. Deshalb denke ich, dass zu wenig reflektiert wird – bei Lehrern in Schulen, bei pädagogischen Fachkräften in Kindergärten. Es wird zu wenig über die eigene Arbeit gesprochen, obwohl das Befriedigung bringen kann.
In meiner Kita sprechen wir im Rahmen unserer Offenen Arbeit immer über ein Kind. Das finde ich oft sehr befriedigend, weil ich mitkriege: Wie sehen die Kolleginnen das Kind? Was ist unser pädagogisches Verständnis? Wir können darüber diskutieren und merken, ob jemand etwas anders sieht.
Ich finde auch, dass es ein Bedürfnis nach klaren Richtlinien gibt. Wir haben das bei der Ampel-Diskussion4 gemerkt, aber auch die Ampel kann man anhand bestimmter Vorgaben selbst modifizieren und gucken: Wie ist das bei uns? Nur wenn man das wirklich durchexerziert hat, dann versteht man es und steht entweder dahinter oder nicht. Also: Maßgaben finde ich gut, wenn man sie diskutieren und der eigenen Kita anpassen kann.
Frauke Hildebrandt: Natürlich gibt es viele Kolleginnen, die Lust haben zu reflektieren. Aber da ist das Entscheidende ja schon passiert! Marie, du weißt, wie du ein Gespräch über ein Kind führen kannst, ohne dass etwas Schlimmes passiert ist oder das Kind was gemacht hat. Dass man sich hinsetzt und fragt: Was macht denn der Peter jetzt eigentlich, womit beschäftigt er sich? Wie können wir ihn in dem, was er tut, unterstützen und eine Brücke zu dem bauen, was er noch nicht tut. Das ist Handwerkszeug, Technik und Prozessgestaltungswissen. Dir ist klar, dass man das machen muss, und du denkst gern darüber nach, was man anders machen könnte.
In Brandenburg bieten wir vielerorts Sprachberatung an und sind in Fortbildungen in Gruppen, Teams und auch übergreifend unterwegs. Dabei stellen wir fest: Es fehlt vielerorts trotz aller Anstrengungen eine Grundidee davon, wie man sich pädagogisch motiviert zusammensetzt und über die Kinder spricht, um Bildungsprozesse zu gestalten. Bei dir, Marie, ist schon so viel Werkzeug da, dass Reflexionsprozesse darauf aufsetzen können, und das bringt euch weiter. Mich bringt es auch weiter, wenn ich reflektiere. Aber Leute, die nicht ständig reflektieren, sind auf eine andere Weise in der Welt. Für sie kann es hilfreich sein, das Handwerkszeug des pädagogischen Denkens und Reflektierens zu erlernen. Ich warne davor zu glauben, dass das Reflektieren eine Kulturtechnik ist, auf die jeder Mensch einfach so zurückgreifen kann, ohne sie Schritt für Schritt erlernt zu haben.
Ich glaube, das ist wie bei der Partizipation: Man braucht eine ziemlich dicke, fette Basis an Grundüberzeugungen, Kenntnissen und Tools, wenn man in sinnvolle Reflexionsprozesse eintreten will. Das kann nämlich auch nach hinten losgehen.
Yvonne Quittkat: Reflektieren braucht einen Orientierungsrahmen, denn: Was sind die Ausgangsfragen? Die Gefahr ist nämlich, dass es sich im Subjektiven erschöpft: Wie finde ich das Kind? Wie findest du das Kind? Aber darum geht es nicht. Es muss beides zusammenkommen: der Reflexionsrahmen und die Kriterien, also der Orientierungsrahmen. Der ist meist nicht allen Fachkräften klar und deshalb nicht nutzbar.
Geht es um Qualitätsverbesserung, bin ich dafür, bei den Erwachsenen nachzujustieren, nicht bei den Kindern. Denn wenn wir Kompetenzen messen, landen wir wieder beim Trichter-Modell: Ich schiebe was rein, und dann kommt was raus.
Frauke Hildebrandt: Das müsste aber nicht so sein! Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Messung von Kompetenzen oder Interessen bei Kindern völlig unabhängig von dem stattfindet, was in der Kita passiert. Und aus dem Messen muss nicht folgen, dass man was in die Kinder reinschiebt, sondern dass man einfach zwischendurch immer mal guckt. Wenn man einen Hefezopf bäckt, schaut man zwischendurch in den Ofen: Wie ist die Temperatur, wie sieht der Zopf aus? Da schreit niemand gleich: Oh, Gott, jetzt messen die schon die Temperatur beim Hefezopf! Ich kann gar nicht mehr frei backen!
Theoretisch müsste es doch möglich sein, immer mal wieder zu gucken: Wie gelingt das, was ich mache? Aber ich habe die Hoffnung verloren, dass man das in den Köpfen von Menschen auseinanderdividiert kriegt. Deshalb würde ich davon abraten, an Kindern irgendwas zu messen, um die Qualität zu verbessern.
Und noch etwas: Wenn man die Ergebnisse bei Kompetenzen und Interessen von Kindern misst, um rauszukriegen, wie gut die Kita-Qualität ist, muss man wissen, dass ihre Kompetenzen und Interessen viel stärker vom Elternhaus bestimmt sind als von der Kita. Will man so etwas messen, muss man vorher die Anregungsqualität im Elternhaus messen, um herauszufinden, welchen Einfluss denn nun die Kita auf die Entwicklung von Kindern hat. Es kann zum Beispiel sein, dass eine super-gute Kita in einem bildungsbenachteiligten Umfeld nicht so gute Ergebnisse bei Kindern hat wie eine Kita, in der viele Eltern von morgens bis abends anregend mit ihren Kindern diskutieren. Das heißt für letztere: Die Kita schadet nicht, auch wenn sie schlecht ist, weil der Einfluss der Eltern so groß ist.
wamiki: Habt ihr eigentlich selbst Qualitätskriterien für eure Arbeit im Team diskutiert und festgelegt – unabhängig von den Vorgaben?
Marie Sander: Kriterien würde ich das nicht nennen. Aber wir haben uns konzeptionelle Gedanken gemacht, in verschiedenen Bereichen. Das sind dann Maßstäbe. Wenn wir sie angucken, sehen wir: Lügen wir uns jetzt in die Tasche? Müssen wir mehr machen? In manchen Bereichen wursteln wir uns durch, aber in Bereichen, mit denen wir uns genauer beschäftigt haben, würde ich das schon so sehen.
Yvonne Quittkat: Auf meiner Ebene waren es Kriterien des pädagogischen Handelns, die so nicht vorgegeben waren. Zum Beispiel: Was heißt es, sich Kindern gegenüber ethisch richtig zu verhalten? Die Reckahner Reflexionen5 waren dabei für mich ausschlaggebend und haben meine Fachberatungstätigkeit sehr beeinflusst.
Frauke Hildebrandt: Ich würde mich auf die Pädagoginnen konzentrieren, aber über Reflexion und biografische Arbeit hinausgehen und sehr deutlich formulieren, was geht und was nicht. Natürlich soll niemand das Reflektieren einstellen, aber klare Ansagen fehlen gerade, besonders in Sachen Partizipation. Da gibt es zu viel rosa Zuckerwatte. Klarheit hilft auch hier weiter.
Außerdem müssen wir viel stärker auf die Alltags-Interaktionen gucken. Viele Qualitätsmessinstrumente richten sich auf Spielsituationen oder darauf, ob die Waschlappen im Bad ordentlich hängen. Wie im Alltag in den Kitas geredet wird – darauf wird noch viel zu wenig geachtet. Auch in der Schule wird die Interaktionsqualität nie überprüft. Da geht es nur um Zensuren. Wie Erkenntnisse in die Kinder kommen, ob Lernprozesse den pädagogischen Standards entsprechen, die wir haben wollen, die wir für richtig halten, das interessiert am Ende niemanden, obwohl es in den Plänen steht.
wamiki: Wenn ihr die Macht und das Geld hättet, bestimmen und steuern könntet – was würdet ihr tun, um die Kita-Qualität zu verbessern?
Marie Sander: Ich glaube nicht, dass mir dieser Job liegt.
Yvonne Quittkat: Ich würde in Fortbildung investieren. Alle Fachkräfte bekämen eine Marte Meo-Ausbildung6. Außerdem würde ich die Praktika-Zeiten am Ende der Ausbildung auf ein Jahr verlängern.
Frauke Hildebrandt: Ich würde die Erzieherinnen viel besser bezahlen. Viele Fortbildungen würde ich streichen und deutlich mehr Hochschulausbildung anbieten. Dadurch kämen mehr Leute mit Hintergrundwissen und Reflexionsübung ins System und auch mehr Männer. Alles würde sich besser mischen, und die Anregungsvielfalt in den Kitas nähme zu. Aber am Bildungsverständnis der Kita wird festgehalten.
Doch das wird dauern. Was wir ändern wollen, ist ja nicht irgendwas. Es ist ein Menschenbild, das über Jahrhunderte anders tradiert ist.
wamiki: Man darf ja mal träumen…
_______________
1Empfehlungen der wissenschaftlichen Expertenkommission zur Bildungsqualität (Köller-Kommission). Der Abschlussbericht ist als PDF im Internet verfügbar unter: www.berlin.de/sen/bjf/Service/presse/abschlussbericht_expertenkommission_6-10-2020.pdf/
2 Kita-Qualität aus Kindersicht. Studie des DESI-Instituts im Auftrag der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung
3 Netzwerk Offene Arbeit Berlin/Brandenburg
4 Verhaltensampel: In diesem Fall ein Instrument zur Verständigung im Team der pädagogischen Fachkräfte über ihr Verhalten gegenüber den Kindern. „Grün“ steht für pädagogisch richtiges, für die Kinder förderliches Verhalten. „Gelb“ steht für Verhaltensweisen, die im Team kritisch betrachtet werden. „Rot“ steht für pädagogisch schädliches Verhalten. Gerade die Auseinandersetzung mit dem gelben Bereich eröffnet Möglichkeiten des offenen Umgangs mit kollegialer Kritik.
5 Die Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen sind zehn Leitlinien, die beschreiben, wodurch sich gute Beziehungen in pädagogischen Settings auszeichnen. Sie können Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften als Orientierung dienen.
6 Marte Meo ist eine Methode der Erziehungsberatung, bei der Video-Aufzeichnung zur Verhaltensbeobachtung und zum Lernen genutzt wird.
Frauke Hildebrandt ist Professorin an der Fachhochschule Potsdam und lehrt im Fachbereich Sozial- und Bildungswissenschaften.
Yvonne Quittkat ist als Fachberaterin im Evangelischen Kirchenkreisverband für Kindertageseinrichtungen Berlin Mitte-Nord tätig.
Marie Sander leitet die Kita St. Thomas in Berlin-Kreuzberg.
 Vorheriger Artikel
Vorheriger Artikel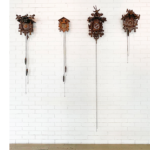 Nächster Artikel
Nächster Artikel