Ins Ohr kriecht er, um von dort seinen Weg bis tief ins Gehirn zu bohren.
Dieser widerwärtigen Tat wird ein unschuldiges Insekt verdächtigt. Der „Eigentliche Ohrwurm“, wie das Tier heißt, krabbelt aber nicht in Menschenohren und kneift auch nicht mit seinen Zangen, was Kinder, die ihn als Ohrenkneifer kennen, im Ferienlager angstvoll befürchten. Seinen Namen bekam er, weil die Römer ihn zermahlten und als Medizin gegen Ohrenschmerzen einnahmen. Ob es half?
Ebenso berühmt wie berüchtigt ist sein Namensvetter, der Ohrwurm. Zuerst in England, dann auch im deutschen Sprachraum aufgetaucht, bezeichnet er musikalische Endlosschleifen im Hirn, eingängige Melodien, die uns erst erfreuen, aber bald foltern. Regelmäßig werden neue Studien zu diesem Phänomen veröffentlicht, weil musikalische Ohrwürmer kommerziell nicht uninteressant sind: Wie komponiert und präsentiert man Musik, die niemand schnell vergisst?
Nur drei Harmonien, wenige Töne und einfache Rhythmen, vermuten manche Experten, liefern das Zeug zum Ohrwurm. Andere betonen, dass man den Text gut verstehen muss, denn das Sprachzentrum gibt den Impuls, welche Stück der Hirn-DJ auflegen soll. Ich finde hingegen, dass die durch den Kopf schießenden Liedzeilen etwas tief im Unbewussten berühren und zum Klingen bringen: Sag mal, summst du auch gerade „Atemlos durch die Nacht“? Huch! Ertappt!
Ohrwürmer können nerven. Wie eine kaputte CD laufen sie im Kopf weiter, viele Stunden lang, und lassen uns den Triumph des Unterbewusstseins spüren. Ich höre sie unverschämt kichern: „Über Freud bist du zwar längst hinweg – aber uns kriegst du nicht klein! Hi, hi…“
Zeichnung: Dagmar Arzenbacher
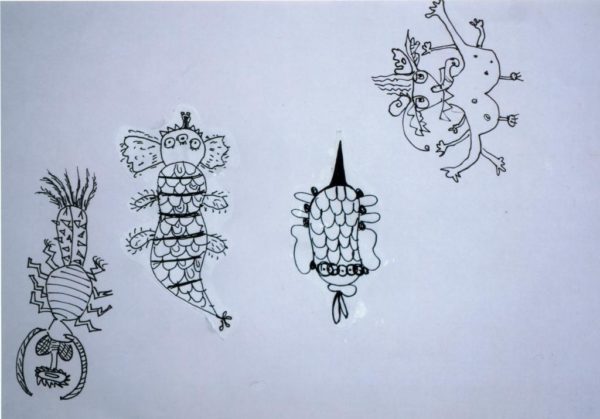
 Vorheriger Artikel
Vorheriger Artikel Nächster Artikel
Nächster Artikel