Wie wir inklusiv arbeiten können. Ich so – Du so. Gut so? Wahnsinn, wie verschieden Kinder, Familien, Kolleg*innen sein können. Wie wir mit der Vielfalt im Alltag umgehen, sie als Chance begreifen können, erzählte die Bildungsreferentin Anne Kuhnert in ihrem Vortrag in Syke.1 Hören wir zu.
Ich lade Sie ein zu einem kleinen Experiment:
Nehmen Sie sich ein Blatt Papier und malen Sie Ihren Lieblingshund. Los geht’s!
Fertig? Wie sieht Ihr Hund aus? Bitte ankreuzen:
Wer von Ihnen hat einen Hund gemalt,
… der von unten zu sehen ist?
… der von oben zu sehen ist?
… der von hinten zu sehen ist?
… der von vorne zu sehen ist?
… der von rechts zu sehen ist?
Und jetzt schauen wir, was vermutlich sehr, sehr viele von Ihnen gemalt haben.
Wer von Ihnen hat einen Hund gemalt, der von links zu sehen ist?
Oh, ha! Überraschung!
Fast alle haben den Hund von links gemalt.
Warum? Warum malen wir jetzt Hunde in wamiki?
Dieses kleine Experiment zeigt den Perspektivwechsel. Das Wort Perspektivwechsel hören wir täglich. Auch ich hörte es immer wieder als ich begann, Pädagogik zu studieren. Parallel arbeitete ich in der Kita. Abends saß ich mit meinen Kindern zu Hause und die Worte der Lehrenden klangen mir in den Ohren: Sie brauchen den Perspektivwechsel. Ja ok. Wir brauchen den Perspektivwechsel. Ich dachte: Gar kein Problem! Gar kein Problem? Bald stellte ich fest: Es gibt einzelne Perspektiven, auf die komme ich gar nicht allein. So sehr ich mich anstrenge. Ich brauche manchmal den Impuls von anderen Menschen, die mir andere Perspektiven aufzeigen.
Ha! Freuen wir uns! Wir arbeiten in Teams, wir sind viele Menschen, wir haben ein Schwarmwissen, wir bringen unterschiedliche Perspektiven mit. Weil wir unterschiedlich sind. Gottseidank! Und wir haben verschiedene Perspektiven auf Menschen: auf Kinder, auf Eltern, auf Familien…
Was unser kleines Malexperiment aber auch zeigt, ist: Scheinbar schauen wir unterschiedlich auf die Welt, auf Kinder, auf Familien. Und doch sind unsere Bilder sehr ähnlich. Denn wir haben gesellschaftliche Bilder im Kopf, die wir alle gelernt haben. Nicht nur bezogen auf die Bilder vom Hund, den die meisten unter uns von links malen.
Wenn wir wirklich durch eine inklusive Brille auf unsere Praxis schauen wollen, dann müssen wir uns anstrengen. Richtig anstrengen. Wir müssen überlegen, wie könnte zum Beispiel der Hund von unten aussehen? Wie könnte die Perspektive aussehen, die ich mir vielleicht im Moment gerade noch gar nicht vorstellen kann? Wie kann das gehen?
Den Hund von unten zu zeichnen, fand ich wahnsinnig anstrengend. Ich male sehr gern, aber ich habe sehr lange gebraucht, um etwas zu malen, das wenigstens halbwegs wie ein Hund von unten aussieht. Es ist schwierig, weil wir das nicht gewohnt sind. Wir haben nicht so viel Praxis darin, andere Perspektiven wahrzunehmen. Ich meine tatsächlich wahrzunehmen. Wirklich auf alle Situationen, auf alle Handlungen und auf alle Menschen inklusiv zu schauen, ist unglaublich anstrengend. Es gelingt uns an einigen Tagen gut. Und an anderen Tagen nicht so gut. Deshalb will ich Sie ermuntern, wenn es den einen Tag nicht so gut läuft, dann am nächsten Tag einfach noch mal von vorn zu beginnen, weiter zu probieren.
Worum geht es eigentlich, wenn wir von Vielfalt als Chance sprechen? Welche Vielfalt schauen wir uns an?

Ich mag diese Grafik, sie zeigt: Es geht umso viel mehr als vielen von uns im ersten Moment dazu einfallen mag.
Aber sehen Sie selbst!
Ach, Inklusion! „Noch eins mehr“, höre ich manchmal in den Teams, die ich als Fortbildnerin besuche… Nein, es geht nicht um „noch eins mehr“, sondern darum, auf alle Prozesse inklusiv zu schauen. Was heißt das konkret?
Mir ist wichtig, einen roten Faden zu entwickeln und zu überlegen, in welchen Arbeitsfeldern arbeite ich überhaupt, was sind eigentlich MEINE Handlungsfelder? Das war für mich als Pädagogin in der Praxis immer wesentlich, überhaupt zu wissen, wer ist eigentlich meine Klientel? In welchen Arbeitsfeldern bewege ich mich?
Es sind in der Praxis mindesten vier Arbeitsfelder:
Ich arbeite mit Kindern, mit Familien, mit meinen Kolleginnen (Das war auch nicht immer so einfach! Dazu später mehr.) und ich arbeite auch mit dem Raum.
Alle vier Handlungsfelder sind miteinander verwoben.
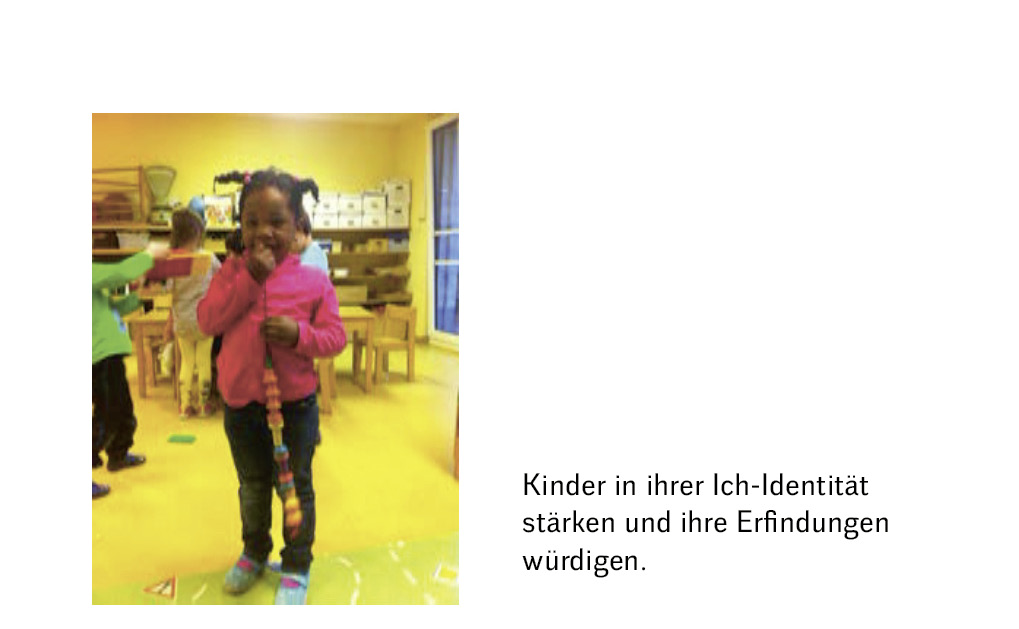
Im Fokus der inklusiven Praxis stehen vier Ziele:
1. Jedes Kind in seiner Ich-Identität und in seiner Bezugsgruppen-Identität stärken
2. Allen Erfahrungen mit Vielfalt ermöglichen
3. Kritisches Denken über Vorurteile, Einseitigkeiten und Diskriminierung anregen
4.Zum Widerstand gegen Vorurteile und Diskriminierung ermutigen
Ich beziehe mich hier auf den Ansatz Vorurteilsbewusster Bildung und Erziehung. (Zum Beispiel die Reihe Inklusion in der Kitapraxis, zu beziehen über wamiki.de – Die Red.)

Arbeit mit Kindern
Elementar wichtig in meiner Praxis war und ist es, Kinder in ihrer Identität und Bezugsgruppen-Identität zu stärken! Ich habe in Berlin-Neukölln als Erzieherin gearbeitet. Berlin-Neukölln, das ist ein Teil von Berlin, der weit über die Stadt hinaus mediale Resonanz erzeugt: Dort brennen nicht jeden Tag die Mülltonnen wie das manchmal in den Medien behauptet wird. Aber es gehörte zu meinem Alltag dazu, dass ich morgens den Sandkasten frei räumte, vom Spritzbesteck zum Beispiel.
Mir war klar, bei uns in Nord-Neukölln, habe ich mit Familien zu tun, die oft von Armut betroffen sind. Unsere Familien in der Kita sprachen sehr verschiedene Sprachen, besaßen unterschiedliche Pässe, verfügten über unterschiedliche Qualifikationen, lebten in unterschiedlichen Familienformen, hatten unterschiedliche Religionen.
Und so fand ich mich in einer bunt zusammengewürfelten Gruppe wieder: 18 Kinder im Alter zwischen zwei und sechs Jahren. Meine Kollegin war oft krank, so war ich viel allein mit den Kindern und ihren 18 verschiedenen Familiensprachen. Die habe ich nie alle gesprochen, obwohl: Ich habe mein Bestes gegeben. Wirklich. Weil südkoreanisch, habe ich gedacht, wird schwierig. Und es wurde schwierig. Also habe ich überlegt: Wie kann ich trotzdem Kinder in ihrer Identität stärken und ihnen nicht den Stempel „Kinder aus Nord-Neukölln“ aufdrücken? Eine Möglichkeit, Kinder zu respektieren und zwar so wie sie sind, ist, das wertzuschätzen, was sie selbst erfinden, produzieren, bauen, gestalten. Und das kann unglaublich viel sein und werden. Regelmäßig hatten wir das Problem, dass zum Beispiel das Gebaute auch wieder abgebaut werden musste.
Und wir hatten auch Familien, die die Erfindungen der Kinder nicht unbedingt wert zu schätzen wussten. Ich sage das jetzt, ohne dass ich Familien stigmatisieren möchte.
Ich selbst bin mit meinen vier Kindern auch „Eltern“ und habe nicht die Möglichkeit, alles Produzierte gleichermaßen zu würdigen. Sie können sich nicht vorstellen, was in etlichen Jahren durch Weihnachten, Geburtstage usw. zusammenkommt, so viele Fensterregale kann ich gar nicht haben, um all das Produzierte von meinen vier Kindern aufzuheben.
Wie lösten wir nun das Problem in der Kita?
Wir bauten ein flaches Regal im Eingangsbereich auf und befestigten eine Digitalkamera mit einer Kette an der Wand. Die Kinder hatten ihre Erfindungen dort auf diesem Bord ausgestellt, versehen mit ihrem Namen beziehungsweise mit einem Bild von sich selbst (für die Kinder, die mit Schriftsprache noch nicht so gut umgehen konnten). Die Kinder haben ihre Erfindungen dort präsentiert, das Gebaute selbst fotografiert bzw. sich von ihrem besten Freund, der besten Freundin damit fotografieren lassen.
Regel war: Das Gebaute darf einen Tag stehen bleiben. Dann wird es abgebaut, und das Material ist wieder für alle zugänglich. Am Ende der Woche haben die Kolleginnen die Bilder auf der Digitalkamera ausgedruckt und die Kinder haben ihre Bilder in ihren Portfolios abgeheftet. Stolz wie Bolle. Das Produzierte war nun für alle Ewigkeit festgehalten. Diese Portfolios gehören den Kindern, sie sind ihre „Bildungsbiografie“, die sie mitnehmen, wenn sie die Kita verlassen. Und sie bleibt bei den Kindern, wenn sie älter werden. Noch heute, zehn, elf Jahre später, treffe ich meine Ex-Kinder, inzwischen Jugendliche, in Nord-Neukölln, die mir voller Freude erzählen, sie haben ihr Portfolio immer noch. Und das alleine ist schon eine unglaublich gute Möglichkeit, Kinder in ihren Identitäten zu stärken und sichtbar zu machen.
Eng verwoben mit der Identitätsentwicklung sind Vorbilder – oft über gesellschaftliche Stereotype geprägt. Diese Prägungen sind manchmal so stark, dass sich Familien als auch pädagogische Fachkräfte immer nur partiell dagegen wehren können.
Ein Beispiel: Der Fasching stand vor der Tür. Alle Jahre wieder: Mädchen möchten Prinzessin sein und Jungen Piraten. Ich gebe zu, ich bin genervt von den Klischees und stänkere gern ein bisschen. „Seid ihr sicher? fragte ich die Kinder. Und: „Ich hätte da noch eine Idee!“
Manchmal reagieren die Kinder genervt, meist aber nicht. „Kennt ihr eigentlich auch Piratinnen?“ Niemand kannte Piratinnen und wir gingen auf Spurensuche. Die berühmtesten Piratinnen der Geschichte waren wohl Anne Bonny und Mary Read, die vor dreihundert Jahren in der Karibik kämpften. Man kann sich jetzt fragen, wie viel Zeit wir mit den besonders blutrünstigen Geschichten der beiden verbrachten… Spannend war aber zu verfolgen, wie die Kinder ihre Rollenbilder veränderten. Die Piratin bekam eine Krone und hatte ihre Waffen unter den Dielen versteckt…
Ok. Ich kann Prinzessin und Piratin sein… Wenn Kinder sagen: „Mädchen können nicht Müllfahrerin werden, weil da nur Männer sind!“, dann sind sie nicht dumm. Es entspricht oft dem, was sie tatsächlich wahrnehmen. In Berlin habe ich zum Beispiel noch keine einzige Frau in den Autos der Müllabfuhr entdeckt. Und ich gucke wirklich gezielt in die Autos der Müllabfuhr, weil ich die unglaublich spannend finde. Einmal war ich in Barcelona im Urlaub und sah ausschließlich Frauen in einem Müllauto. Ich bin voller Begeisterung auf die Straße gesprungen (kein Witz!), habe das Auto angehalten und gefragt, ob ich ein Foto machen darf. Und habe ein Foto von dieser Müllabfuhr gemacht, weil ich es nicht fassen konnte. Also für mich selbst. Nicht nur für die Kinder, auch für mich selbst, weil ich dachte „Müllfahrerin, wie spannend!“. Und damit Kinder zu konfrontieren, auch das ist Aufgabe in diesem Feld des inklusiven Arbeitens.
Ein anderer wesentlicher Teil inklusiver Praxis ist, dass Informationen für alle verständlich sind. Wirklich für alle!

Ich arbeite gerade mit vielen Teams zusammen, die auch geflüchtete Kinder betreuen.
Vielen Kindern und ihren Familien sind Kitas fremd. Sie vermuten gar nicht, wie viele subtile Abläufe es in Kitas und Schulen gibt. Das Händewaschen im Waschraum für sehr junge Kinder zum Beispiel. Wie geht das? Ein Team hat es mit den Kindern fotografiert: Erst die Ärmel hoch, dann das Wasser andrehen, die Hände nass machen, die Seife nehmen, abwaschen, abtrocknen und gucken, ob das Licht aus ist… Das ist für alle hilfreich. Jeder kann nachschauen, ist es verständlich, sich überprüfen. Ich kann nur teilhaben, wenn ich informiert bin, wenn ich weiß, worum es überhaupt geht.
Ein anderer Klassiker: Sand in der Garderobe. Das Thema zieht sich durch Kita, Schule und Haushalt. Jeder Mensch, der mit Kindern lebt, kennt Sand im Haus. Auch ich mit meinen nun älteren Kindern habe ständig Sand in der Wohnung. Ich hasse Sand unter meinen Füßen. Außer am Strand. Ich bitte dann meine Kinder: „Ach bitte, seid so nett, macht doch diesen Sand weg.“ Ein Kita-Team mit viel Sand im Haus hat mit den Kindern die Abläufe fotografiert, wie der Sand wieder verschwindet. Das war für alle Kinder gut, nicht nur für die schwerhörigen. Auch die Erwachsenen profitieren, je mehr Bilder sie verwenden. „Ach, schau doch noch einfach mal drauf.“ Statt vieler Worte genügt ein Impuls zur Selbstkontrolle. Wir vereinfachen Abläufe nicht nur für Kinder, auch für uns. Das ist inklusives Arbeiten: Wir überlegen, wie kann es gelingen – für alle Kinder, für die Familien und die Fachkräfte?
Informationen für alle, mit den Kindern entwickelt, berühren zwei Handlungsfelder: die Interaktion mit Kindern und die Gestaltung der Räume.
Zur Raumgestaltung gehört auch das Spielmaterial. Als Pädagogin, die sich mit Inklusion auseinandersetzt, gehe ich oft durch die Spielwarenabteilung. Ich sehe Überraschungseier in Rosa oder Germany’s Next Topmodel im Kleinformat und denke: „Oh mein Gott!“.
Und gleichzeitig – und das finde ich interessant – haben Teile der Spielzeugindustrie inzwischen begriffen, dass Diversität auch ein Markt sein kann. Der ist noch lange nicht so umfassend wie der Mainstream-Markt, geteilt in Rosa und Blau. Ich war fasziniert, als Lego eine Sonderedition zu den Frauen in der NASA herausgebracht hat. Die Botschaft: Frauen und Männer machen es möglich, dass die space shuttles in das All fliegen. Interessant wäre auch, mal zu zeigen, welche tollen Männer in vermeintlichen Frauenberufen arbeiten, da zieht die Spielzeugindustrie langsam nach.

Arbeit mit Familien
Ein anderes pädagogisches Handlungsfeld ist das Arbeiten mit Familien. „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ – das ist meine Erfahrung, insbesondere dann, wenn es sprachliche Hürden gibt und für die Familien das Kita-System neu ist. Wie kann ich Familien mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen darüber informieren, was an diesem großartigen Ort Kita überhaupt passiert? Ich habe mit Stefani Boldaz-Hahn ein Bildbuch ohne Worte mit vielen Zeichnungen von alltäglichen Situationen in der Kita entwickelt. Darin finden Sie typische Situationen und Abläufe aus dem Kita-Alltag gezeichnet: Wie kann ich mein Kind in der Kita anmelden? Was passiert in der Eingewöhnung? Wie sieht ein normaler Tagesablauf in der Kita aus? Was muss ich beachten, wenn mein Kind krank ist? Mithilfe der Bilder können Erzieher*innen die Abläufe und Regeln in der Kita erklären. Bilder mit Gegenständen wie Wechselwäsche oder Brotdosen zeigen, was die Kinder für die Kita mitbringen sollten. Ein Kalender und eine Uhr zum Ausklappen helfen, Organisatorisches zu klären: „Wir starten um 10.00 Uhr und sind um 14.00 Uhr wieder zurück.“ usw. Das Buch eignet sich nicht nur zum Erklären, sondern lädt auch ein, miteinander ins Gespräch zu kommen. Nicht nur pädagogische Fachkräfte können das Buch nutzen, auch Mitarbeiter*innen in Ämtern, die über Kindertagesbetreuung informieren, können von dem Buch profitieren. (Interessierte Fachkräfte können das „Bildbuch: Kita-Alltag“ mit einer E-Mail an publikationen@bundesregierung.de bestellen. Die Red.) Für den Informationsaustausch mit Familien brauchen wir mehr als eindimensionale Zettel-Wege. Ich als Mutter bin immer wieder fasziniert von der Fülle der A4-Zettel, die meine vier Kinder aus der Schule nach Hause bringen: Elternabend, Ausflug, Schließtag… Wissen Sie, wie viele dieser Zettel ich wirklich intellektuell kognitiv noch erfassen kann? Ich würde sagen – gefühlt zehn. Ich habe versucht, diese Zettel an eine Wand zu hängen. Ich mache mir mit meinem Smartphone unendlich viele Fotos. Ich versuche in meinem Gehirn mir diese vielen Infos auf den Zetteln zu merken. Aber ich schaffe es einfach nicht. Genau genommen fühle ich mich überfordert. Vollkommen. Für mich reicht die Info: Elternabend, Thema, Uhrzeit. Wer geht? Ok, ich komme. Wenn da noch steht, bring etwas mit, ok, dann kaufe ich noch schnell eine Packung Kekse. Fürs Kuchenbacken fehlt mir leider die Zeit. Und ich freue mich über jede Erzieherin meiner Kinder, die mir ins Gedächtnis ruft: „Anne, morgen ist Elternabend. Kommst du?“ Verdammte Axt! Ich hatte es vergessen.

Wie kriegen wir das hin? Inklusives Denken berücksichtigt die Verschiedenheit von Eltern. Achtung: Wir sind wieder beim „Hund“. Es gibt vielleicht die Eltern, die all diese Zettel lesen; Eltern, die sich all das merken (der „Hund von links“) und es gibt auch andere Eltern wie mich (vielleicht der „Hund von unten“…). Also Eltern, die versuchen, alles bestmöglich hinzukriegen und es trotzdem manchmal vergessen, die dann noch mal kurz eine Erinnerung von einer respektvollen Erzieherin brauchen und die sich wie ich über einen kleinen Trost freuen: „Anne, du bist nicht die Einzige, die es vergisst.“ Gottseidank!
Arbeit im Team
Ein anderes pädagogisches Handlungsfeld ist das Zusammenarbeiten im Team und spätestens hier brennt die Luft in manchen Teams. Wir stellen fest, dass die Auseinandersetzung mit Inklusion und Verschiedenheit sich nicht nur auf „die Eltern“ und „die Kinder“ beschränkt. Wir müssen auch auf die Ressourcen schauen, die wir als Team haben. Ich erzähle Ihnen eine kleine Geschichte von meiner Kollegin Monika und mir. Meine Kollegin Monika war so eine Art Urgestein in meiner Kita, das Team dort arbeitete mehr oder weniger seit 35 Jahren zusammen. Dann kam ich, Anfang 20, hochmotiviert und voller Idealismus. Keine Arbeit schien mir zu schwer, ich schaffe es! Und ich bekam den Kellerraum. Ich sollte eine neue Gruppe übernehmen und bewegte mich nun zwischen Heizungsrohren und kleinen schmalen Fenstern in Deckennähe. Und alle Kinder, die in besonderer Art und Weise anstrengend schienen oder die die Kollegen überfordert hatten, landeten auf wundersame Weise in meiner Gruppe im Keller. Monika, meine Kollegin, war eine Koryphäe, wenn es um das Besorgen und Präsentieren von Materialien ging. Die hatte ein prächtiges Regal, da waren wahre Schätze in fabelhafter Ordnung sortiert: Papiere nach Farbe, Stärke, Größe; Pfeifenreiniger nach Farben, Glitzer, Pailletten; Einhorn mit Glitzer, Einhorn ohne Glitzer; Kreiden, Stifte und viele andere mehr.

Meine Leitung Sissi, eine Frau mit echter Berliner Schnauze, hat damals zu uns gesagt: „Monika und Anne, ihr seid doch echt bescheuert! Ja genau, ihr beide! Monika hat eine tolle Kompetenz. Anne hat eine tolle Kompetenz. Warum seht ihr das nicht im Zusammenspiel?“ Sissi hatte recht. Denn Monika war großartig im Beschaffen dieser Materialien, die hat über diesem Geschäft gewohnt, wo man das alles bekam. Irgendwann muss sich der Inhaber in Monika verliebt haben. Also: Wenn am Freitag um 16.00 Uhr der braune Pfeifenreiniger weg war, dann war Montag früh um 7.00 Uhr der wieder da. Irre.
Monika wusste nur nicht, mit dem Material umzugehen. Ich aber! Ich habe mit den Kindern Ausstellungen produziert, Vernissagen veranstaltet.
Eigentlich ergänzten wir uns großartig. Das haben wir beide damals nur nicht so gesehen. Bei Monika und mir hat es über ein Jahr gedauert, bis wir das wirklich hingekriegt haben. Inklusives Arbeiten braucht auch unser aktives Auseinandersetzen mit Diversität im Team. Wir dürfen als Erwachsene Kindern keine Doppelmoral vorleben, sondern zeigen, wie wir selbst mit Unterschieden im Team zurechtkommen. Respekt und Achtung nur als Lippenbekenntnisse von Erwachsenen – das durchschauen Kinder meist sehr schnell.
„Buffet mit Inklusionskonfetti“
Dieses Auseinandersetzen kann auch mit vielen kleinen Impulsen gelingen. Ich nenne das „Inklusionskonfetti“. Sie kennen das sicher, nach gefühlten sieben Jahren Kindergeburtstag finden wir in den Ritzen der Dielen immer noch den Einhorn-Konfetti, dabei hatten wir den doch entsorgt. Denkste! So ist es auch mit dem „Inklusionskonfetti“. Eine Kollegin hatte mir geschrieben: „ Anne, vor vier Jahren hatten wir eine Teamfortbildung. Ich war dagegen, was du damals gesagt hattest! Du weißt noch? Und jetzt kriege ich es nicht mehr aus dem Kopf.“ Ha! So funktioniert „Inklusionskonfetti“. Wir kriegen es nicht mehr weg.
Für inklusives Arbeiten gibt es viele, viele Möglichkeiten.

Weitere Beispiele stelle ich Ihnen kurz vor. Vielleicht werden Sie sagen: „Ahhhh! Das machen wir schon so.“ Ok, dann nehmen Sie das als Zuspruch. Vielleicht werden Sie aber auch bei Anderem, was Sie vielleicht noch nicht kennen, denken: „Na, das weiß ich aber nicht, ob ich das mag.“ Was ich Ihnen vorstelle, ist ein bisschen wie ein Buffet im Hotel. Es schmeckt einem nicht alles, was man dort vorfindet. Aber das muss es auch nicht. Sie haben die Auswahl. Und vielleicht ist auch einiges dabei, bei dem Sie sagen, das ist für mich wie „der Hund von unten“.
 Nun zu den Beispielen. Die vier pädagogischen Ziele sind mein roter Faden:
Nun zu den Beispielen. Die vier pädagogischen Ziele sind mein roter Faden:
Wichtig ist, die Identität jedes Kindes zu stärken und allen Erfahrungen mit Vielfalt zu ermöglichen. Um dann Kinder anzuregen, auch kritisch über Ungerechtigkeit und Diskriminierung zu denken und sie zum Widerstand gegen Vorurteile und Diskriminierung zu ermutigen.
Kennen Sie die Spiele mit dem eigenen Bild und Diversität?
Zum Beispiel am Eingang: Bin ich heute da oder nicht? Die Kinder haben sich von vorn und von hinten fotografiert. Wenn sie in die Kita kommen, drehen sie ihr Bild um. Zu sehen ist das Kind von vorn. Wenn das Kind die Kita verlässt, dreht es sein Bild wieder um. Zu sehen ist das Kind von hinten. (Achtung: Dieses Eingangsspiel für die Kinder ersetzt natürlich nicht die Anwesenheitsliste.)
Manchmal gibt es Familien, die aus unterschiedlichen Gründen es nicht schaffen, Fotos der Kinder mitzubringen oder es nicht erlauben. Auch kein Problem. Dann malen sich die Kinder von vorn und von hinten. Jedes Kind ist dabei! Denn genau darum geht: JEDES Kind ist sichtbar und kann sich in seiner Identität wiederfinden. Es hilft weder dem Kind noch uns, Eltern absichtlich oder unabsichtlich abzuwerten.
Wohl mit keinem Material dieser Welt spielen Kinder so gerne wie mit Materialien von ihnen selbst. Und Material wie dieses ist einfach herzustellen.
Die Kinder in meiner Kita haben mich gefragt, warum ich überall Bilder von ihnen aufhänge. „Was denkt ihr denn?“ habe ich zurück gefragt. „Weil du uns so magst.“ „Genau! Ich mag euch alle ganz doll.“, war meine Antwort. Aber das war nicht der eigentliche Punkt: Es geht mir darum, den Kindern das Gefühl zu geben, dass ich auf jedes von ihnen gleichermaßen schaue. Denn das trägt zum Wohlbefinden bei und dazu, dass die Kinder Lust haben, mitzumachen, bereit sind, sich mit Vielfalt auseinander zu setzen und auszuhalten, dass sie verschieden sind.
Wie reagieren Sie zum Beispiel, wenn ein vierjähriges Kind zu einem anderen Kind sagt: „Deine Haut sieht aus wie Kacke.“
Ich schlage vor: Erst mal bitte tief Luftholen und überlegen: Kacke ist ein elementares Thema für Kinder zwischen zwei und vier Jahren. Ich kenne Erwachsene, die einen regelrechten Tanz um das Töpfchen aufführen, wenn das Kind auf selbigem sitzt. Es gibt viele wunderbare Bücher zum Thema Kacke und Kackfabriken. Wenn Kinder Unterschiede bemerken, dann vergleichen sie die mit für sie permanent wichtigen Dingen. Also auch mit Kacke. Das Kind braucht also eine Kompetenz, über Verschiedenheit zu sprechen, ohne dem anderen weh zu tun. Sprich Wörter, die es ihm ermöglichen Vielfalt zu benennen. Und mit einem empörten Aufschrei: „Das sagt man nicht!“ kann das Kind vermutlich wenig anfangen. Das sagt man nicht? Da frage ich mich immer: Wer ist eigentlich „man“? Wo wohnt „man“? Wie sieht „man“ aus? Warum sagt „man“ das nicht?
Ich habe damals zu dem Kind gesagt: „Weißt du, es kann sein, dass es Y. wehtut. Weil das Wort etwas ist, was sich für Y. nicht besonders gut anfühlt. Lass uns doch mal ein anderes Wort finden: Was kann denn noch so braun sein wie die Hautfarbe von Y.? Und welche Hautfarbe hast du? Lass uns mal schauen, welche Farben können wir für deine Hautfarbe nehmen? Und wir sind mittendrin in der Auseinandersetzung mit Vielfalt und – zack die Bohne – auch beim kritischen Denken.
Ein weiteres Beispiel: Kennen Sie die Tradition der Postkartenzüge? Ich meine die mit Urlaubspostkarten nachgebauten Eisenbahnzüge an der Wand. In meiner Kita war es so, dass ein Viertel aller Kinder mit ihren Familien im Urlaub nach Argentinien, Japan, Thailand und weiß nicht wohin geflogen sind. Der „Rest“ – die anderen drei Viertel – hatten keine Möglichkeit, eine Postkarte aus dem Urlaubsland zu schicken. Weil: Es gab keinen Urlaub. Ich habe irgendwann diese Postkarten von der Wand genommen, weil sie drei Viertel der Kinder stetig daran erinnerten: Ich kann nicht teilhaben. Ein Viertel der Kinder hat weiter Postkarten geschickt, ich habe sie vorgelesen, in das Portfolio einsortiert und meinen Kindern vorgeschlagen: „Lasst uns doch mal selbst Postkarten gestalten und verschicken.“ Wir haben die Karten mit Marke vorbereitet, die Kinder haben sie mit den Eltern zu Hause auf ihre Weise geschrieben und in den Briefkasten eingeworfen. Alle Postkarten trudelten irgendwann in der Kita ein, alle sahen unterschiedlich aus und jedes Kind hatte eine. Das ist für mich ein Grundprinzip inklusiven Arbeitens, dass die Kinder Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdecken. Wenn ich die Kinder darin begleite, kritisch zu denken, sind sie auch kritisch zu mir. Das ist für uns Erwachsene schwer auszuhalten, weil wir es nicht gewöhnt sind, dass nun schon junge Kinder beginnen, uns zu kritisieren. Dazu gehört auch, sich zu üben, wie Widerstehen und sich Positionieren aussehen können.

Beltz Verlag.
Wenn wir eine inklusive Gesellschaft wollen, müssen wir exklusive Mechanismen kritisch wahrnehmen. Es braucht einen Minimalkonsens. Ich finde es unglaublich schwierig als Fortbildnerin in Teams zu arbeiten, in denen die Kolleginnen mit verschränkten Armen vor mir sitzen und sagen: „Hallo, wir sitzen nur hier, weil der Träger das so will!“ Es ist ungleich einfacher, wenn ich verstanden habe, dass es inklusives Arbeiten braucht, um die Gesellschaft voranzubringen. Wenn ich Verschiedenheit sensibler wahrnehme, brauche ich Netzwerke. Support Clubs. Gruppen, die es mir ermöglichen, mich auszutauschen und immer wieder zu erfahren, dass andere ähnlich denken, ähnlich arbeiten. Ich versuche mich selber kritisch zu reflektieren, meine Kita zu analysieren, auf einer konkreten Handlungsebene… Das ist eine Never Ending Story. Das macht das Leben aber auch so schön, dass wir entdecken, wir werden nie fertig. Manchmal fragen die Kolleginnen mit den verschränkten Armen: „Wann sind wir denn nun mit Inklusion fertig?“ Dann sage ich: „Hoffentlich nie!“ Das würde ja bedeuten, eine Idee zu haben, wie viele verschiedene Verschiedenheiten es gibt. Und aus die Maus. Vielfalt heißt aber viel mehr anzuerkennen, dass Menschen so unterschiedlich sein können, wie ich es mir vielleicht gar nicht vorstellen kann. Und dass ich immer wieder auf Menschen treffen werde, die noch mal anders denken und noch mal etwas anderes mitbringen als ich selbst. Sie werden dann Kolleginnen erleben, die sagen: „Ich bin im Widerstand!“ Und ich sage immer: „Hurra, hurra, der Widerstand ist da!“ Besser kann es gar nicht sein, als dass wir auch auf Menschen treffen, die nicht unserer Meinung sind. Das wäre ja soooo langweilig, wenn wir alle einer Meinung wären. Wir können um Positionen ringen und schauen, wie wir sie zusammenführen. Wir vergessen dabei unsere Netzwerke nicht, wir sind geduldig miteinander, jede und jeder von uns hat unterschiedliche Arbeitstechniken und das ist auch gut so. Wir gehen fehlerfreundlich miteinander um. Niemand von uns hat gelernt, inklusiv zu arbeiten. Wir erarbeiten uns alle eine inklusive Praxis, und dabei machen wir Fehler. Das ist nicht schlimm. Das sage ich den Kindern auch, das ist wie Fahrradfahren lernen. Hinfallen, aufstehen, und noch mal von vorne beginnen. So lange, bis wir das Gefühl haben, jetzt läuft es gut. Und dann kommt wieder ein Kind, bei dem es nicht funktioniert, dann müssen wir uns etwas Neues überlegen.
Das sind die Mac-Gyver-Strategien, die wir brauchen. Mit fast Nichts, aber viel Empathie, Herzblut, kritischem Denken, Erfindungsreichtum und Standvermögen sprengen wir die Grenzen. Das kriegen wir hin, das ist das Arbeiten von Pädagog*innen, deswegen mag ich meine Arbeit so. Alles andere wäre auch zu einfach.
1. Anne Kuhnert am 26. Januar 2019 auf der 11. Pädagogischen Fachtagung: „Zusammen sind wir bunt“ in Syke/Schleswig-Holstein.
 Vorheriger Artikel
Vorheriger Artikel Nächster Artikel
Nächster Artikel
Hallo!
Den langen Beitrag habe ich mit Interesse, aber auch mit Beklemmungen gelesen. Sobald Eltern unsere Sprache nicht verstehen, ist der Sinn eines gezielten Einsatzes von Bildern nicht zu bestreiten. Unangenehm erinnert hat mich die mit der Matschhose und den Gummistiefeln beginnende Bildkartenserie an die die früher in vielen Kitas verwahrten Plakate zur Herstellung eines Obstsalates. Die Genauigkeit ging so weit, dass den Kindern anschaulich gezeigt wurde, wie eine Banane geschält wird, bevor sie im Obstsalat landet. – Alle Kinder wussten es natürlich schon längst.
Weniger ist mehr! Vor allem, wenn auf das Laminieren und Plastikhüllen verzichtet wird,
Freundliche Grüße
Angelika Mauel