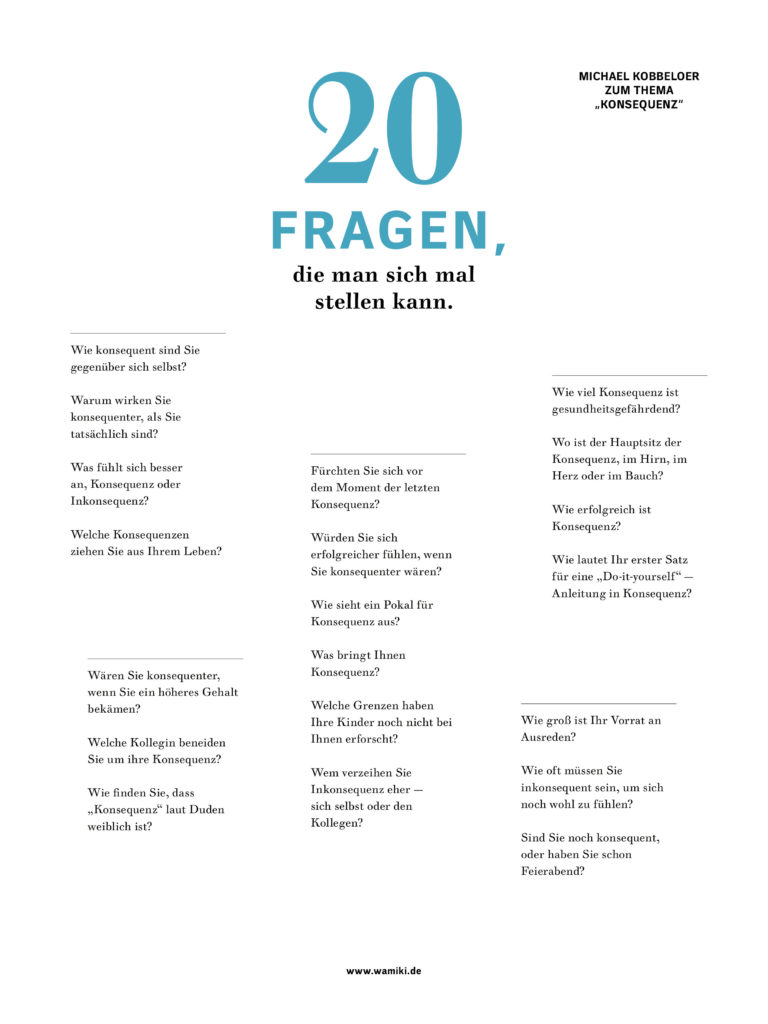Am besten erst mal gar nichts. Aber: hingucken und zuhören.

Erwachsene mischen sich viel zu schnell ein, wenn Kinder streiten. Mir passiert das auch.
Bei einer Fortbildung in Mediation bekam ich erhellende Tipps, nämlich: Nicht gleich fragen, wer böse war, wer Schuld hatte, sondern beide Streitparteien anhören und sich vergewissern, ob man sie richtig verstanden hat. Überraschend ist, dass das tatsächlich häufig schon reicht. Die Kinder erleben, dass sie wahrgenommen werden, können loswerden, was war, und wenden sich dem wieder zu, was sie vorher taten, oder machen was Anderes.
Außerdem ist es so: Werden Kinderstreitigkeiten von Erwachsenen unterbunden, brechen sie später oft wieder aus, weil die Konflikte nicht ausgesprochen oder geklärt sind, sondern weiter schmoren. Hinzu kommt: Streit gehört zum Leben. Kinder müssen lernen, wie man sich auseinandersetzen kann, ohne dass es Tränen oder blutige Nasen gibt.
Foto: Thomas K. | photocase.de
Wie oft haben Sie den Satz „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ schon als Rechtfertigung für Ihr Handeln genutzt?
Wie oft haben Sie schon das Gesicht verloren?
Um wie viele Wörter müsste Ihre Arbeitsplatzbeschreibung verlängert oder gekürzt werden, um die Realität abzubilden?
Wie fühlen sich Kolleginnen, die Ihnen zum ersten Mal begegnen
Betrachten Sie gemeinsames Kaffeetrinken, die Weihnachtsfeier und das kollektive Erzählen schmutziger Witze schon als Teamentwicklung?
Wenn eine Kollegin Sie um Hilfe bitten, denken Sie dann an Montessoris
Leitsatz „Hilf mir, es selbst zu tun“? Oder sagen Sie: „Mach schnell, ich hab´s eilig“?
Haben Sie eine Kollegin, die das Zeug hat, eine große Pädagogin zu werden, sagen es ihr aus Neid aber nicht?
Was genau würde sich im Bildungssystem ändern, wenn die Kultusministerkonferenz ausschließlich mit Schulversagern und Schulverweigerern besetzt wäre?
Wie begründen Sie Ihrem Vorgesetzten, dass das Prinzip „Lernen durch Einsicht“ bei Ihnen genetisch nicht funktioniert?
Wären Sie gerne Ihre eigene Kollegin? Nein? Warum nicht?
Nimmt Ihre Kooperationsbereitschaft mit zunehmendem Dienstalter eher zu oder ab?
Wäre Ihre Einrichtung besser, wenn alle so arbeiten würden wie Sie?
Wie viele Teammitglieder können Sie uneingeschränkt weiterempfehlen?
Wenn Sie Ihre Meinung über die Vorgesetzten am Monatsende schriftlich abgeben müssten, würden Sie ordentlich, außerordentlich oder fristlos gekündigt?
Wie viele Feinde haben Sie in Ihrer Einrichtung?
Haben Ihre Kolleginnen ein Gewissen? Woran merken Sie das?
Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie oft brechen Sie die Regeln, die andere für Sie aufgestellt haben?
Angenommen, Sie könnten eine Regel aufstellen, an die sich alle Teammitglieder halten müssten – welche wäre das?
Kann eine Praktikantin allein aus Ihrem Handeln Ihre pädagogische Haltung ableiten?
Wenn es einen Aufsichtsrat aus Kindern in Ihrer Einrichtung gäbe, würde man Sie dann entlassen?
Was ist die größte Erfindung der letzten 2000 Jahre? Die Dampfmaschine? Das Internet? Das Bett? Mitchel Resnick vom MIT Media LAB gibt eine andere Antwort: Der Kindergarten! Weiter lesen…
Eltern und Konsequenz. Was raten Ratgeber? Weiter lesen
MICHAEL KOBBELOER ZUM THEMA „LANGSAMKEIT“
Macht Langsamkeit schneller glücklich?
Wie lang müsste eine Frage sein, damit sie „langsam“ wirkt?
Wie schnell ist Langsamkeit wirklich?
Wo hat Langsamkeit Ihr Leben schneller gemacht?
Vermissen Sie eine Notbremse in Ihrem Leben?
Ist man langsam letztlich schneller?
Hat Langsamkeit einen tieferen Sinn?
Würden Sie gern schneller lesen können?
Wären Sie erfolgreicher, wenn Sie schneller wären?
Schließen „Schnell“ und „Qualität“ sich aus?
Lohnt sich Langsamkeit?
Haben Sie ein schlechtes Gewissen, weil Sie langsam sind?
Was ist schnelle und was langsame Pädagogik?
Sind Sie sicher, dass Sie wissen, was Langsamkeit ist?
Wer ist langsamer, Frauen oder Männer?
Was geht nur schnell?
Cosma Hoffmann, Diplom-Psychologin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Greifswald:
Keine leichte Frage, denn es gibt eine Vielzahl Definitionen, aber keinen Konsens darüber, welche nun die „richtige“ ist. Die wohl bekannteste und oft zitierte stammt von Jon Kabat-Zinn – dem Mann, der Achtsamkeit in unseren westlichen Kulturkreis integrierte wie kaum ein anderer. Er gab der Achtsamkeit einen säkularen Anstrich und ermöglichte so einen weltanschaulich neutralen Zugang.
Ursprünglich entstammt das Konzept der Achtsamkeit dem Buddhismus und bedeutet in Kabat-Zinns Worten: „Auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein, bewusst, im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen.“ Kabat-Zinn bringt zwei Kernaspekte, die in fast allen Definitionen immer wieder genannt werden, wunderbar auf den Punkt: die absichtsvolle Lenkung der Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt und eine akzeptierende Haltung gegenüber den Empfindungen, die wir dabei haben.
Doch der gegenwärtige Augenblick – das Hier und Jetzt – ist ein theoretisches Konstrukt, auf das wir unsere Aufmerksamkeit nicht lenken können. Vielmehr lenken wir sie auf Stellvertreter dieses Augenblicks, und das sind unsere Gedanken, Gefühle und Empfindungen, die genau in dem Moment auftreten. Deshalb ist der Körper in Achtsamkeitsübungen so zentral, denn er ist es, der alle Sinneseindrücke des gegenwärtigen Augenblicks wahrnehmen kann.
Vielen von uns fällt es schwer, auf das Hier und Jetzt fokussiert zu bleiben, weil Achtsamkeit flüchtig ist. Die Gedanken stehen nie still, wir fangen an zu planen oder zu grübeln und – zack! Unsere Aufmerksamkeit ist nicht mehr im Moment, sondern mit der Vergangenheit oder Zukunft beschäftigt. Aber wir erleben auch Augenblicke, in denen wir achtsam sind. Besonders gut gelingt uns das in schönen Momenten, wenn wir eine Tasse guten Tee genießen oder ein interessantes Gespräch führen.
Die Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Moment aufrechtzuerhalten lässt sich allerdings trainieren. Atemmeditation ist eine der bekanntesten Methoden. Es klingt simpel: Setz dich hin und konzentriere dich auf deinen Atem. Ungeübte merken schon nach wenigen Atemzügen, wie sich ihr unruhiger Geist rührt und Gedanken durch den Kopf kreisen lässt, die wiederum bestimmte Gefühle auslösen. Vielleicht stöhnen sie frustriert: „Was für eine dämliche Übung“ und halten sie für Zeitverschwendung. Oder sie ärgern sich, weil sie etwas vermeintlich so Leichtes wie konzentriert zu atmen nicht schaffen. Solche Gedanken können ganze Kaskaden weiterer Gedanken auslösen, und die Aufmerksamkeit für den Atem ist hin.

Dieses Gedankenkarusell lässt sich nur selten stoppen, aber wir können es verlangsamen. Dafür ist entscheidend, dass wir die Gedanken und Gefühle erstmal registrieren: einfach schauen, was da ist – egal, ob angenehm oder unangenehm –, und diesen Empfindungen offen, neugierig und akzeptierend begegnen. Das gibt uns die Möglichkeit, Gedanken oder Gefühle anzuschauen und sie dann loszulassen, ohne uns in ihnen zu verlieren. So können wir mit der Aufmerksamkeit immer wieder in den gegenwärtigen Moment zurückzukehren, auch wenn wir mal abgeschweift sind.
Die Haltung der Achtsamkeit erschließt sich letztendlich nur in der Praxis. Zwar braucht es viel Übung, die Aufmerksamkeit zu regulieren und eine akzeptierende Haltung zu kultivieren, aber diese beiden Aspekte bergen eine große Kraft für unseren Alltag.
Viele Probleme entstehen, weil wir uns wünschen, Negatives zu vermeiden und Positives festzuhalten. Erfahrungen nicht zu bewerten, scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, sichert uns diese Fähigkeit doch das Überleben. Es gehört zur biologischen Grundausstattung, Unangenehmes zu meiden und Angenehmes zu bewahren. Mit einer achtsamen Haltung betrachten wir angenehme und unangenehme Erfahrungen aber gleichwertig. Beide haben ihre Daseinsberechtigung und sind, für sich genommen, weder gut noch schlecht, sondern gehören zum Leben. Wer achtsam ist, nimmt seine Gefühle und Gedanken so an, wie sie sind, und akzeptiert schwierige Situationen ohne den Wunsch, sofort etwas verändern zu wollen.
Unangenehme Gefühle wie Angst, Trauer oder Wut mögen wir ebenso wenig wie unvernünftige Gedanken. Deshalb greifen wir im Alltag häufig zu schnellen Lösungen aus dem Repertoire bekannter Muster, die schon in der Vergangenheit nicht halfen. Taucht ein Problem auf, macht einer sich ein Bier auf, ein anderer zündet sich eine Zigarette an oder erhofft sich Entspannung bei der neuesten Netflix-Serie.
Vermeidende Strategien können sich auch in impulsiven Verhalten äußern: Bin ich wütend, mache ich mir sofort Luft; habe ich Angst, laufe ich weg. Solche Strategien mögen zwar helfen, die eigene Stimmung positiv zu beeinflussen – aber nur kurz. Irgendwann merken wir, dass sie uns davon abhalten, das zu tun, was uns eigentlich wichtig ist. Eine achtsame Haltung kann helfen, diese Strategien als Notlösungen zu erkennen, die in uns angelegten Mechanismen aufzuspüren und zu unterbrechen. Denn oft führen impulsive Reaktionen dazu, dass wir Dinge tun, die wir später bedauern oder die uns von unseren eigentlichen Zielen entfernen.
Empfinde ich Angst, meine Meinung öffentlich zu vertreten, und gebe dem Impuls nach, lieber nichts zu sagen, dann unterdrücke ich den Wunsch, zu meinen Überzeugungen zu stehen. Aus solchen Mechanismen auszusteigen heißt, den Sinnen Aufmerksamkeit zu schenken: Welche Gefühle und Gedanken sind da? Dabei fallen gewohnte Muster irgendwann auf. Erkennen wir sie, können wir uns aus ihrer Umklammerung lösen. Wie Beobachter registrieren wir sie, ohne uns dafür zu verurteilen. Der Effekt: Es entsteht eine Pause, eine Verlangsamung der automatisierten Reaktion – und diese Pause schenkt uns Freiheit. Nämlich die Freiheit zu entscheiden, was wir wirklich tun wollen.
Es scheint paradox, dass Akzeptanz und das Annehmen der Dinge, wie sie sind, zu einer Veränderung führen sollen. Aber das wertfreie Betrachten der Gedanken und Gefühle, die auftauchen, sorgt dafür, dass wir auch wirklich hinschauen. Denn wir können nur das verändern, dem wir uns zuwenden, das wir nicht wegdrücken oder vermeiden. Kabat-Zinn schreibt in seinem Buch „Gesund durch Meditation“, dass wir nur diesen Moment haben. Nur im gegenwärtigen Moment können wir wirken und unser Handeln steuern. Die Vergangenheit ist verstrichen, wir können sie nicht ändern. Die Zukunft ist ungewiss. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment lenken und annehmen, was ist, uns nicht in automatisierte Mechanismen verstricken – dann wächst in uns die Gewissheit, Gestalter des eigenen Lebens zu sein.
Foto: Beate-Helena / photocase.de
Warum sind Sie ein Superheld?
Warum hat man Sie noch zu keiner „Pädagogen-Superstar-Show“ eingeladen?
In welchen Momenten Ihres Lebens wurden Sie zum Superhelden?
Welche Probleme der Menschheit haben Sie für sich schon gelöst?
Angenommen, Sie müssten wählen: Würden Sie Ihre Ideale leben oder Superheld werden?
Ist es anstrengend, ein Superheld oder eine Superheldin zu sein?
Was fehlt Ihnen noch zum Superhelden?
Woran erkennt man einen Superhelden?
Wie sieht Ihre typische Superhelden-Handbewegung aus?
Sind Sie allein aufgrund Ihrer Ideale ein Superheld?
Wer ist der Superheld oder die Superheldin in Ihrer Einrichtung?
Welche Situation in ihrem Leben hatte eher Antihelden-Status?
Welchen Unterschied macht es, ob Sie der Superheld sind oder jemand anderes?
Sind Sie noch auf der Suche nach dem Helden oder der Heldin in sich?
Wenn Sie unterwegs sind – ist das dann eine Heldenreise?
Gibt es einen Superhelden, dem Sie Ihr Glück verdanken?
Hat ein Superheld Ideale?
Wie wird man Superheld?
Wie viele Leute, die sich für Superhelden halten, sind es wirklich?
Sind Pädagogen eher Helden oder Antihelden?
In dem Verb „petzen“ schwingt mit, dass es sich um etwas Negatives, zumindest Unerfreuliches handelt. Dabei geht es, wenn Kinder „petzen“, eher ums Bescheid-Sagen. Ist Bescheid-Sagen doof?
Stellen wir uns mal vor, drei Kinder sitzen im Buddelkasten, und es gibt Krach. Eins kommt zur Erzieherin und sagt: „Peter hat Marie die Schippe weggenommen.“ Da erhebt die Erzieherin den moralischen Zeigefinger und sagt zu dem Kind: „Du sollst nicht petzen.“
Aber: Welche Motivation hat ein Mensch – jung oder alt – eigentlich, wenn er Bescheid sagt? Nennt man ihn Petze, unterstellt man ihm etwas Denunziatorisches: Er will die anderen in die Pfanne hauen oder sich einen Vorteil erschleichen.
Ich glaube, dass das meist nicht stimmt. Derjenige, der Bescheid sagt, kann nämlich ein Mensch sein, der sieht: Hier passiert etwas, das wir nicht allein regeln können, sondern Beratung oder Unterstützung brauchen. Dieser Mensch ist mutig, finde ich, denn er durchbricht den Konsens, den es in Gruppen häufig gibt: Was hier passiert, bleibt unter uns. Mutig ist dieser Mensch, weil er Verantwortung übernimmt, sich dem Gruppenkonformismus verweigert und sagt: Nein, das bleibt nicht unter uns.
Diffamiert man so einen Menschen als Petze, ist das so wirkungsvoll wie bei der Mafia: Verrat ist das Allerletzte. Tut man das in der Kita, sorgt man dafür, dass alles Mögliche unter die Decke gekehrt wird, und die Kinder lernen: Auch wenn ich Unrecht erlebe – zur Erzieherin sollte ich deshalb nicht gehen, weil der Wert, der Gruppe beizustehen, höher ist als der Wert, Unrecht zu benennen.
Dass junge Kinder beim Bescheid-Sagen ihren eigenen Vorteil im Blick haben oder sich bei den Erwachsenen einschleimen wollen, finde ich schon deshalb unwahrscheinlich, weil es fast nie gelingt, denn: Ein Kind, das „petzt“ oder Bescheid sagt, hat in der Regel damit zu rechnen, dass es mit seiner Aussage nicht ernst genommen wird.
Ich vermute, die Figur der „Petze“ – oder des Kindes, das Bescheid sagt – wird in östlichen und westlichen Kitas unterschiedlich bewertet. Meine These ist, dass der Bescheid sagende Mensch im Osten stärker als im Westen diskreditiert wird. Im kollektivistisch geprägten Osten ist der Gruppen-Zusammenhalt wichtiger als das Individuum und seine Eigenverantwortung, und zwar erst recht, wenn jemand dem Gruppendruck wiedersteht und sich nach außen wendet. Dass Erwachsene es als Kompetenz werten, wenn ein Kind Bescheid sagt, weil es allein nicht weiterkommt – das ist wahrscheinlich überall nicht weit verbreitet.
Oder?
Teaserfoto: Alpenfux / photocase.de
Welchen Sinn hat eine Mücke in Ihrem Schlafzimmer?
Was hat die Natur Ihnen zu verdanken?
Welches Naturgesetz wäre in der Pädagogik sinnvoll?
Welche Werte hat die Natur?
Wie genau sieht der Klimawandel in Ihrer Einrichtung aus?
Wenn die Natur weinen oder lachen könnte – worüber?
Welchen Fehler würde die Natur niemals zugeben?
Wann haben Sie das letzte Mal mit einem Baum gesprochen?
Wie wird die Natur in 50 Jahren aussehen?
Wo gibt es ein Benutzerhandbuch für die Natur?
Was an Ihnen ist noch Natur?
In welcher Hinsicht ist die Natur eine Enttäuschung?
Gibt es etwas Sinnloses in der Natur?
Wie viel Natur ist noch natürlich?
Glauben Sie, dass Sie der Natur etwas schulden?
Wie lautet der erste Satz, mit dem Sie die Natur über den Klimawandel informieren?
Wann haben Sie das letzte Mal den Sternenhimmel länger als 30 Sekunden betrachtet?
Weitere Fragen findest Du in unseren wamiki-Ausgaben