Hier gibts den Artikel als PDF: prosa Fuchs_#6_2020 „Was gab es heute im Kindergarten zu essen?“, frage ich das kleine Kind. „Mittag“, sagt sie. Ich sitze in vegetarischer Familienkonstellation beim Abendbrot, also abgespeckt, nur das kleine Kind und ich. Der Rest der Familie kommt in einer halben Stunde nach Hause, ein Teil nass und nach…
Auf meinem Schreibtisch steht das medizinische Modell eines menschlichen Gehirns, und wenn mir nichts mehr einfällt, staune ich über diese seltsamen Windungen, die in ihrer Struktur an einen aufgeschnittenen Rotkohl erinnern und in denen all unsere Ideen über Gott und die Welt verborgen sind – und die tägliche Frage, was wir kochen sollen. Das hat viel mit der Vorstellung zu tun: Was kann sich mein Hirn als mögliche Speise vorstellen, und was akzeptiert es nicht? Meines zum Beispiel akzeptiert kein Hirn. Ich esse fast alles – außer Hirn. Ein einziges Mal in meinem Leben habe ich Hirn gegessen, oder eher nicht gegessen, bis heute spüre ich eine butterweiche , scheußliche Masse auf der Zunge.
Jede Familie hat ihre Essgeschichten: ihr Lieblingsessen, verhasstes Essen, ihre Fest-und Urlaubsessen. Eins der schönsten Dinge am Sommerurlaub in Italien war für uns Kinder das Essen. Morgens zogen wir los und übten im Singsang bis zur Bäckerei die Worte: sei panini grandi, aus Angst, sie sonst zu vergessen. Die Panini waren so anders als unsere Brötchen, größer und fluffig, dazu gab es unschlagbar köstliche Aprikosenmarmelade. Und erst die Spaghetti, die wir in meiner Erinnerung von morgens bis abends aßen! Nichts war herrlicher, als ermattet und ausgehungert von einem Tag am Strand, noch voller Salzwasser, das einem aus den Ohren herauslief, eine riesige Portion Spaghetti zu vertilgen, die hier so viel besser schmeckten als in Hannover. Wenn der Abschied nahte, nahmen wir nicht nur traurigen Abschied vom Meer, sondern auch von dem Essen, das die genau richtige Portion an Fremdheit besaß. Einmal, auf der Heimfahrt, bei einem Zwischenstopp in den Alpen, gab es als Hotel-Kindermenü etwas für uns völlig Fremdes: Kalbshirn. Fotografisch genau erinnere ich mich an die Platte mit Silberhaube, die herangeschwebt kam, an das dramatische Lüpfen der Haube – und die grauen Häufchen, die dort lagen, für jedes Kind eins. Wir schrien iiii und ooooh und mochten es auf keinen Fall anrühren, denn allein die Vorstellung verschlug uns den Appetit. Wir mussten es auch nicht aufessen, aber allen ist es in unvergessener, wenn auch unterschiedlicher Erinnerung. Gab es wirklich vier Kalbshirne für vier Kinder? Dachten wir, wir würden kalbsähnlich durch das Verspeisen eines Kalbsbrägen? (Brägen hieß bei uns der dumme Kopf, in den zum Beispiel das Einmaleins nicht Einzug halten wollte.) Und was hatte das Kalb wohl mit seinem kleinen, grauen Hirn gedacht? Ganz sicher nicht, dass es irgendwann vor uns auf dem Teller liegen würde! Und wenn wir uns vor Kalbshirn ekelten, ekelten sich die Kalbshirn-Fans vielleicht vor Spaghetti? Fremdes Essen spielt in vielen Geschichten eine große Rolle. Als Mutprobe, als Hexenspeise oder Wundermahl, als Zeichen, die bekannte Welt zu verlassen und sich dem Unbekannten zu öffnen. Das Hirn, das keiner von uns essen mochte, dachte sich über unsere Ignoranz seinen Teil. Ich habe nie wieder Hirn probiert.
Vielleicht ein Fehler. Neulich stieß ich auf das Rezept „Falsches Hirn“ aus gebratener Leberwurst und Eiern. Wer hat sich das nur ausgedacht?
wamiki-Tipp:
Die Geschichte „Ein Hirn für jedes Kind“ erzählt Doris Dörrie in ihrem neuen Buch: „Die Welt auf dem Teller“: Knusprige Brotkrusten, Eier von glücklichen Hühnern, familiäres Miteinander bei spanischer Paella, Innehalten bei grünem Tee mit japanischen Reisbällchen und Kindheitserinnerungen an Melonen-Momente – wenn Doris Dörrie über das Essen schreibt, liest sich das, als umarme sie die Welt. Essen und Kochen sind für sie Inbegriff von Lebensfreude und Genuss, Grund zur Dankbarkeit und Eigenverantwortung und ein Weg zum besseren Verständnis unserer selbst und der Welt, die uns umgibt.
 Doris Dörrie, Die Welt auf dem Teller
Doris Dörrie, Die Welt auf dem Teller
Inspirationen aus der Küche
208 Seiten, gebunden,
Diogenes, Zürich 2020, 22 Euro
Text: Doris Dörrie
nach einem Kita-Platz … und wie die Geschichte weitergeht Weiter lesen

Das Leben, das wir hatten, ist stehen geblieben, aber nicht weg,
nur stehen geblieben.
Und nun schaut es sich um.
Aha.
Wer bisher, wie ich, dadurch in Balance war, dass er wie auf einem Fahrrad gestrampelt ist, der fällt um, wenn er nicht absteigt.
Ich hab das Fahrrad jetzt, also das Metaphernfahrrad, auf dem ich metaphorisch gestrampelt bin, weggestellt.
Anderes Tempo jetzt.
Letztes Jahr bin ich einmal richtig toll vom Metaphernrad gestürzt. Da musste ich auch absteigen, aber da bin ich über den Lenker geflogen und hatte eine blutige Nase.
Bremsen ist schwer heutzutage. Stress fährt einem immer hinterher.
Das Absteigen diesmal war leichter, weil alle anderen auch abgestiegen sind und niemand von mir erwartet, dass ich dasselbe Tempo habe wie sonst.
Alle haben ein anderes.
Die Post ist langsam. Die Abgabetermine werden verschoben. Die Bahnreisen sind abgesagt und selbst wenn nicht, sind die Bahnhöfe fast leer. Es gibt keine Termine, zu denen ich zu spät kommen könnte.
Da gibt es nichts schönzureden dran. Das ist jetzt einfach so.
Bei dem Wort Entschleunigung muss ich gleich mal ganz achtsam in meine Armbeuge kotzen. Kann ich nicht mehr hören. Es war ja eher eine Vollbremsung und jeder hat sich dabei was Anderes gestoßen, gezerrt und verstaucht. Außerdem ist der Stress auch nicht weg. Der rennt jetzt vielleicht nicht mehr hinterher, aber er sitzt neben einem auf dem Sofa, und so nah wollte man ihm auch nicht kommen. Jetzt muss man sich mit dem Stress unterhalten. Was wolltest du eigentlich die ganze Zeit von mir? Warum rennst du mir hinterher?
Der Stress sagt: „Meine Zunge war in deine Fahrradkette eingeklemmt. Du bist immer weiter gerast. Ich bin auch völlig fertig.“
Wie gesagt, nichts zum Schönreden. Krasser Film, in dem wir alle mitspielen.
Jetzt sind wir getrennt. …Ihr seid da, aber jeder woanders. Das ergibt jede Menge dadada.
Und es heißt ja auch nicht Sein, sondern Dasein.
Foto: Cassie Boca/Unsplash
Es lohnt sich, den Kleinsten unter uns gut zuzuhören: Nicht selten haben Kinder die beste und ehrlichste Antwort parat – etwa auf blöde Reden Erwachsener. Leserin W. erzählte mir folgende Anekdote: Ihre zwei Töchter, zwei und vier Jahre alt, sitzen mit ihr am Frühstückstisch. Die Ältere, schon ein Kindergartenkind, hält der Jüngeren einen ausschweifenden Vortrag…
Kirsten Fuchs bummelt durch die Welt. Mit ihrer Tochter, sechs Jahre alt. Einen der schönsten Momente während unsere Reisen erlebten wir in Indien. Es war eine Gruppenreise mit Familien. Meine Tochter war die jüngste und die einzige, die kein Englisch sprach. Also brachten ihr die anderen Kinder englische Wörter bei. Als wir durch die wunderschöne…
Kirsten Fuchs bei der Buchdealerin ihres Vertrauens Weiter lesen…
Kirsten Fuchs erinnert sich an den Moment, als sie den Kapitalismus durchschaute.
In unserem pädagogischen Fachmagazin probieren wir immer wieder neue Formen aus. Michael Fink, Fortbildner und Autor der ersten Stunde, hat deshalb für #wamiki 3/2017 „Komm heim“ mehrere Märchen geschrieben. Im Heft geht es ja vor allem um Heimat, Fremde und Identität und da passen Märchen ganz wunderbar. Wer denkt nicht bei Heimat an die Hausmärchen der Gebrüder Grimm? Märchen sind eine bedeutsame und sehr alte Textgattung, in denen von wundersamen Begebenheiten erzählt wird. Wundersame pädagogische Begebenheiten? Aber lest selbst!
Besuch vom Amt für nachträgliche Geburtenkontrolle
… sind Kirsten Ehrhardt und Kirsten Jakob. Beide haben Kinder mit Behinderung und sind in Elterninitiativen für Inklusion in Baden-Württemberg aktiv. So erleben und hören sie eine Menge Inklusives und weniger Inklusives. Darüber schreiben sie jede Woche auf ihrem Blog:
Schnuppern
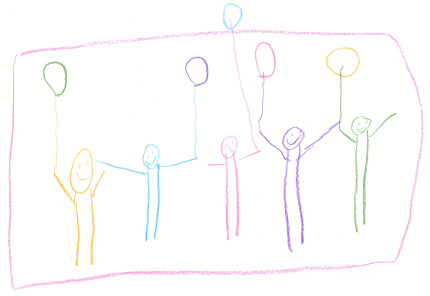 Heute ist Schnuppertag im Kindergarten. Die Mutter ist glücklich, denn es ist eine inklusive Einrichtung. Schon einige Kinder mit Down-Syndrom waren dort. Fotos von ihnen hängen eingerahmt im Flur. Lachende lustige Kinder. Auch das mädchen ist mit dem Down-Syndrom geboren worden.
Heute ist Schnuppertag im Kindergarten. Die Mutter ist glücklich, denn es ist eine inklusive Einrichtung. Schon einige Kinder mit Down-Syndrom waren dort. Fotos von ihnen hängen eingerahmt im Flur. Lachende lustige Kinder. Auch das mädchen ist mit dem Down-Syndrom geboren worden.
Die Erzieherin nimmt es freundlich in Empfang. Die Mutter geht nach Hause. Als sie mittags wieder kommt, sitzt das Mädchen mit einem Stück Knete in der Hand in einer Ecke. Die Erzieherin schaut nicht mehr ganz so freundlich. Sie erzählt: Das Mädchen sei ja sehr still. Sehr misstrauisch. Habe nichts mitmachen wollen. Habe um sich geschlagen, als die anderen es in den Kreis holen wollten. Habe schließlich ganz allein für sich gemalt. Allerdings nur Krickelkrakel. Und gelächelt: kein einziges Mal.
Die Mutter nickt. Sie kennt ihre Tochter schließlich gut.
„Wir haben uns hier eigentlich bei der Inklusion auf Kinder mit Down-Syndrom spezialisiert“, sagt die Erzieherin, „weil die immer so reizend sind. Aber ich spreche mal mit dem Team. Vielleicht können wir bei Ihrer Tochter auch mal eine Ausnahme machen.“
Raus
 Und raus jetzt!
Und raus jetzt!
Widerwillig rollt er dann immer aus dem Klassenzimmer in den Raum, der „Differenzierungsraum“ heißt. Manchmal heißt er auch „Inklusionsraum“.
„Ich will hierbleiben bei meinen Freunden“, sagt
der junge heute. „Aber im kleinen Raum kannst Du Dich viel besser konzentrieren“, sagt die Sonderpädagogin, „hier ist es viel zu laut für Dich!“
„Mir ist es nicht zu laut“, murmelt er und bleibt einfach sitzen. Zwischen all den fröhlich schwatzenden Kindern.
„Aber ICH kann mich hier nicht konzentrieren!“, ruft die Sonderpädagogin laut.
Er rollt mit den Augen. Und stellt die Bremse an seinem Rollstuhl noch ein bisschen fester.
Bärchen
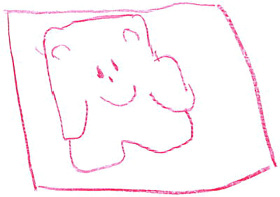 Heute gibt es das Diktat zurück. Alle schauen aufgeregt, welche Zensur sie bekommen haben. Sein bester Freund kommt zu ihm: „Und was hast Du?“
Heute gibt es das Diktat zurück. Alle schauen aufgeregt, welche Zensur sie bekommen haben. Sein bester Freund kommt zu ihm: „Und was hast Du?“
Er hält ihm das Blatt hin. Einen langen Text hat er nicht geschrieben. Dafür alle Namen der Klassenkameraden.
Alle richtig geschrieben. „Janis“ hatte er besonders lange geübt. Unter den Wörtern sind drei Bärchen aufgestempelt. Breit grinsende Bärchen.
„Hä“, sagt sein Freund, „was issen das für’n Scheiß?“
Er zuckt mit den Achseln. Ein anderer Junge kommt dazu.
Auch er schaut sich das Blatt an: „Du hast doch alles richtig“, sagt er, „dafür müsstest Du eine 1 bekommen.“
„Wart mal `nen Moment“, sagt sein Freund. Sie warten, bis die Lehrerin sich umdreht. Heute bringt er stolz seine erste „1“ mit nach Hause. Groß und rot steht sie unter drei grinsenden Bärchen. Mit einer ziemlich unleserlichen und krakeligen Unterschrift. Wie Unterschriften halt so aussehen.
Elternabend
„Das wäre doch schön“, sagt ein Vater beim Elternabend, „wenn sich die Inklusionseltern einmal vorstellen.“
Stille.
Niemand meldet sich.
Nicht der Vater, der von Geburt an nur eine Niere hat.
Auch nicht die Mutter, die seit langem schon in psychiatrischer Behandlung ist.
Auch nicht der Vater, der inzwischen mit einem anderen Vater zusammenlebt.
Und auch nicht die Mutter des Kindes, das nach der Trennung der Eltern wieder jede Nacht ins Bett macht.
Und auch nicht die Eltern des Jungen, der schon mit drei Jahren fließend lesen konnte.
Und auch nicht die Mutter des mädchens.
Schließlich einigt man sich.
Alle Eltern stellen sich einmal kurz vor.
Und jeder erzählt über sich und seine Familie, was er möchte.
Gruppen
 Ein großer Runder Tisch.
Ein großer Runder Tisch.
Es geht um Inklusion in der ersten Klasse.
Die müsse man „gruppenbezogen“ umsetzen, zitiert der Schulrat aus dem Gesetz.
Auf der einen Seite sitzen die Eltern der Kinder mit Behinderung, die für die eine Gruppe in der einen ersten Klasse vorgesehen sind.
Auf der anderen Seite sitzen die Eltern der Kinder mit Behinderung, die für die andere Gruppe in der anderen ersten Klasse vorgesehen sind.
Die Eltern der Kinder ohne Behinderung sind nicht eingeladen. Sie melden ihre Kinder einfach ganz normal im Sekretariat an.
Am Ende der Sitzung nicken alle Eltern. Der Schulrat ist erleichtert.
Er hat seine „Gruppenlösungen“ unter Dach und Fach.
Die Direktorin steht auf.
„So“, sagt sie energisch und fröhlich, „heute haben wir aber das letzte Mal von irgendwelchen Gruppen gesprochen. Ich habe hier an meiner Schule nur Klassen und Kinder. Herzlich willkommen!“
Bei der Junge und das Mädchen handelt sich nicht um dieselben, sondern um verschiedene Kinder. Alle Geschichten sind wahr.
Ich war 2014 in eine blöde Lage geraten. Sagen wir mal, das Jahr fühlte sich an, als wäre ich wie Obelix als Kind in einen Topf mit Zaubertrank gefallen, nur dass mein Zaubertrank nicht stark machte, sondern ab 35 unglücklich. Erst ging es mir persönlich schlecht, dann beruflich, denn persönlich ging es mir so schlecht, dass ich meinen groß angekündigten Roman beim großen Verlag nicht zum Abgabetermin beenden konnte. Kein Buch, kein Geld.

Ich war verschuldet und hielt es für eine gute Idee, das Jobcenter um Hilfe zu fragen. Eine gute Idee ist es gegen einen Stromzaun zu pullern, aber nicht zum Jobcenter zu gehen, wenn man Hilfe braucht.
An der U-Bahnstation in der Nähe des Jobcenters reihte ich mich ein in die Wanderung der Bedürftigen. Alles strömte Richtung hässliches Gebäude. Auf den letzten Metern zog das Tempo an, damit man doch einen Platz weiter vorne in der Schlange ergatterte. In welchen Zaubertrank waren die anderen Menschen als Kinder gefallen? Welche Erfahrungen, Enttäuschungen, Verfehlungen, Konzentrationsstörungen, Krankheiten, Feinde, Irrwege und Drogen haben sie hierhergebracht? Sind sie dieses arbeitsscheue Pack?
Ich war es jedenfalls nicht. Ich wollte eine Aufstockung beantragen und zwar für ein halbes Jahr, denn dann sollte der Roman fertig sein und wieder Geld fließen.
*
Ich bekam viele Anträge ausgehändigt: Anlage A, Beiblatt zu Anlage C, Ausführhilfe, Sonderblatt, Faltanleitung für einen Papiersarg.
Ich ging nach Hause, der Ort, wo es warm und sicher ist.
Draußen immer noch eine Schlange aus Menschen, die Hilfe brauchen.
Zuhause legte ich den Antrag erst einmal drei Tage lang an eine Stelle, wo ich ihn nicht sah, denn so erledige ich Dinge, für die man sieben Tage Zeit hat. Am vierten Tag holte ich den Antrag raus und überlegte, wie schön es sein müsste, ein Nagetier zu sein. Man zernagte den Antrag und hätte ein neues Nest.
Für Leistungen vom Jobcenter musst du leiden. Das musst du nachweisen und dann musst du erst Recht leiden. Leiden gegen das Leiden. Ein Konzept wie Salzpflaster. Oder Wellnessdornenkrone.
In dem Antrag sollte ICH beweisen, wie schlecht meine Auftragslage ist. Könnt ja sonst jeder kommen, sagen die, die immer sagen: Könnt ja sonst jeder kommen. Und wo kämen wir denn hin, wenn jeder käme?
Freunde sagten mir: „Du musst dein Konto leer machen. Ganz leer.“
Ich sagte: „Aber die Miete. Meine Versicherungen. Die Kitakosten. Das ist doch sowieso schon geborgtes Geld.“
Freunde sagten: „Mach das weg. Versteck das.“
„Aber dann ist doch auf meinem Konto nichts.“ Meine Stimme schlotterte.
„Du musst hoffen, dass das Amt schnell genug bezahlt.“
„Uff!“ sagte ich „Das ist aber unangenehm.“
Wie arm muss ein Mensch sein, um arm zu sein? Wie wenig darf ein Mensch haben, um Hilfe zu bekommen?
Der Antrag war schlimmer als zwei Steuererklärungen. Da ich wechselnde Auftragsgeber habe, ist das bei mir immer sehr viel Papierkram. Anstatt den Roman zu beenden, den ich beenden muss, saß ich auf dem Boden und sortierte mein letztes Jahr.
Bei einigen Sätzen im Antrag, gelang es mir nicht, ihnen ihre Bedeutung zu entlocken. Ich schlug nach in Deutsch-Amtsdeutsch, Amtsdeutsch-Deutsch, doch trotz erhöhter Bemühung um Verständigung blieben Sachlage A wie U mir ungeklärt.
Ich trug meine Papiere zu einer Beratungsstelle, wo ehrenamtlich geholfen wird, Anträge zu besiegen.
*
Eines Tages werde ich ein kompliziertes Computerspiel programmieren. „Jobcenter. Bist du zäh genug?“ Du brauchst alle Anträge, alle Nachweise und musst das richtige Zimmer finden. Die Flure sind lang und in den Wartezimmern verlierst Du drei von Deinen sieben Leben beim Warten.
Die ersten drei Level des Keinjobcenterspiels:
Level eins: Gehe hin, hole den Antrag.
Level zwei: Fülle den Antrag aus. Erkenne deine Grenzen.
Level drei: Gehe zur Beratungsstelle. Eine Unterkategorie „der Engel“ wird dir helfen.

Ein Schild auf der ausgeblichenen Bluse verriet mir, dass Frau Würzebesser sich meiner angenommen hatte. „Hier eine Unterschrift leisten“, schnarrte sie, als wäre sie ein großes Kissen mit Gegensprechanlage. In ihrem Gesicht das weise Nichts, welches bereits alles gesehen hatte. Gegen Frau Würzebesser ist unsere Kanzlerin eine wilde Feuersbrunst. Trotzdem und deshalb gehörte dieser Frau sofort mein ganzes Herz. Still und emsig half sie. Sie blätterte sich durch mein mieses Jahr. Alles stand da: das immer kaputte Auto, die kaputte Beziehung, die Trennung, der verschobene Roman, der Kummer mit der Kita, der Kitawechsel.
„Zahlt er Unterhalt?“ fragte sie.
Ich schüttelte den Kopf.
„Ist er noch bei Ihnen gemeldet?“
Ich nickte.
„Dann gibt’s auch kein Unterhaltsvorschuss.“
Sie schaute mich frei von Wertung an. Sie dachte nichts, empfand kein für mich unerträgliches Mitleid und ebenso auch keine Abscheu. Ich liebte sie sehr in diesem Moment.
„Alles nachrechnen“, sagte sie, bevor der Moment zu romantisch wurde. Sie verwickelte ihre weichen Arme, als ob eine Tiefseemuräne um die andere kroch.
„Haben Sie vielleicht einen…?“
Traurig schüttelte sie den Kopf: „Nein, wir haben keine Taschenrechner. Die bekommen wir nicht gestellt.“
„Gut, ich gehe in den Aufenthaltsraum, um alles in Ruhe nachzurechnen. Gibt’s irgendwo Kaffee?“
„Nein, wir haben hier keine Kaffeemaschine und keinen Automaten. Das haben wir beantragt.“ Frau Würzebesser nickte so knapp, dass es geradeso den Grundvoraussetzungen für Nicken entsprach.
Der Mangel an Kaffee stimmte mich so traurig, dass ich weinen mochte, aber ich hatte den passenden Antrag nicht bei mir und bestimmt bekamen sie in der Beratungsstelle keine Taschentücher gestellt. Außerdem sollte ich in meiner Situation weder Flüssigkeit noch Salz verschwenden, beschloss ich, denn bestimmt war nur einmal Weinen pro Woche vorgesehen.
So wie Frau Würzebesser gesagt hatte „Das haben wir beantragt“ klang es wie: „Wir haben es in die Felsspalte geflüstert.“
Ich wollte Frau Würzebesser etwas Gutes angedeihen lassen, aber ich befürchtete, dass sie Pralinen genug gegessen hatte und mit einem Blumenstrauß schlicht die Akten von Staub frei wedeln würde.
„Gut, ich gehe Taschenrechner kaufen, drüben bei diesem Billigladen. Wie viele soll ich mitbringen?“ schlug ich vor.
Kurz blitzte etwas in ihren Augen. „Neinnein“, winkte sie ab. „Das Amt soll uns welche stellen. Irgendwann werden sie es tun. Wir können warten.“
Ich verstand.
Es ging ums Prinzip.
Das war hier was Buddhistisches.
Ein Kampf der Geduld.
Ich hatte einmal eine Aufnahme gesehen, in der Seesterne sich bewegten. Man hatte es schneller abgespielt und wirklich: Sie krabbelten hin, sie krabbelten her.
Frau Würzebesser, die Beratungsstelle, das Amt: Alles hatte Seesterntempo.
Ich kann überhaupt nicht gut warten. Nachdem mein Antrag für ein halbes Jahr Aufstockung abgegeben war, verging ein halbes Jahr, bis ich welches bekam. Warten ohne Geld auf Geld ist schlimm und schlimm ist untertrieben. Ich dachte manchmal an Frau Würzebessers verschlungene Arme und so ließ sich das Warten aushalten.
*
Im Computerspiel „Jobcenter. Bist du zäh genug?“ folgten nun
Level vier: Warteschleife
und Level fünf: verlorene Unterlagen
und Level sechs: Telefonate
und Level sieben: Würde bewahren.
Was kann schon passieren, wenn man so einen Antrag auf Unterstützung endlich ausgefüllt hat?
Sie können ihn ablehnen. Okay.
Er kann in der Hauspost verschwinden? Quatsch! DOCH! Dochdochdoch, kann er.
Ich hatte meinen Antrag hingebracht und in die Hauspost geworfen, das geheime Portal ins Paralleluniversum, wo alles genauso ist wie in unserer Welt, auf die wir uns geeinigt haben, alles genauso, nur das Wort für Jobcenter ist „Ole-ole-die-Post-ist-weg“.
Ich wartete einen Tag ohne Geld, eine Woche ohne Geld. Statt Geld kam ein Brief vom Amt, der schon beim Öffnen Militärmusik schmetterte und im gewohnten Strammstehen-sonst-Schimpfe-Tonfall verfasst war. Ihre Unterlagen, Frau Fuchs, wo sind denn die, häh? Bitte reichen Sie diese ein bis zu dem Tag, den wir nennen: „Gestern!“
 Ich verbrachte einen Tag mit Telefon am Ohr. Die Warteschleifenmusik des Amtes war ein Stück gespielt auf Gitarrensaiten aus Katerhoden. Ich stellte mir vor, wie es einmal eine Maßnahme für Musiker gegeben hatte, in der dieses Stückchen Wartequälerei entstanden war. Dem Musiker wären sonst die Bezüge gekürzt worden und was will man mit gekürzten Bezügen? In gekürzte Bezüge passt ja kein Kissen mehr rein und man liegt ganz unbequem.
Ich verbrachte einen Tag mit Telefon am Ohr. Die Warteschleifenmusik des Amtes war ein Stück gespielt auf Gitarrensaiten aus Katerhoden. Ich stellte mir vor, wie es einmal eine Maßnahme für Musiker gegeben hatte, in der dieses Stückchen Wartequälerei entstanden war. Dem Musiker wären sonst die Bezüge gekürzt worden und was will man mit gekürzten Bezügen? In gekürzte Bezüge passt ja kein Kissen mehr rein und man liegt ganz unbequem.
Als ich dachte, ich wäre nun tot und in der Hölle wäre die neue Strafe diese Warteschleife, war ich plötzlich dran. Ich war dran! Eine menschliche Stimme sprach zu mir. Eine echte. Leider wollte sie eine Nummer von mir, und wenn ich keine Nummer hätte könnte ich ja auch nicht eine bekommen, denn man bräuchte ja eine Nummer erst einmal, um eine Nummer zu bekommen.
Den restlichen Tag dachte ich darüber nach, ob beim Amt weder Huhn noch Ei entstanden wären, einfach, weil kein Antrag auf Schale gestellt worden war.
Beim nächsten Telefonat erfuhr ich die Beruhigungsformeln für wütige Antragsteller: Man würde in drei Tagen den Abteilungsleiter informieren.
Würde, würde, dachte ich, würde Würde ich noch haben, würde ich euch nicht brauchen.
Würde, würde, schwere Bürde.
Sollte, sollte, Hass und Revolte.
Hätte, hätte, Antrag weg.
Ein Schimpfbrief, in welchem von „Umgehend“ und „Kein Anspruch“ die Rede war und zwei Telefonate später, waren meine Unterlagen irgendwie wiederaufgetaucht. Kuckuck hatten sie gerufen und waren beim Hausmeister aus dem Papierkorb gehopst.
ABER natürlich fehlte etwas.
Whuhuhaha, lachte ich hysterisch, als ich erfuhr, dass meine Kontoauszüge ja nun nicht mehr aktuell wären. Wessen Schuld ist denn das, wollte ich brüllen, aber ich weinte stattdessen ganz leise in das winzige Taschentuch, das mir geblieben war, dass ich aus alten Socken gefertigt hatte und zwischendurch immer fein auswusch und mit Körperwärme trocknete, um Heizkosten zu sparen.
Ich sollte die Kontoauszüge faxen, sagte der Mensch vom Amt. Das ginge schneller und lande gleich beim Richtigen. Und so tat ich, wie mir geheißen.
Dann hieß es wieder warten und Instantwasser essen.
*
Ich bin ein freundlicher Mensch und wartete anstatt zu drängeln, denn die Menschen vom Amt sind ja auch Menschen und man soll sie nicht anschreien (auch wenn’s schön wäre. Für einen selbst. Für die eben nicht.). Sicher, irgendwann werden sie von Maschinen ersetzt werden und diese werden freundlich selbst die ganzen Anträge ausfüllen.
Dann rief ich doch an und fragte nach. Ein Fax sei von mir nicht angekommen. Der sicherste Weg sei, alles persönlich vorbeizubringen und in den Hausbriefkasten zu werfen. Bei dem Wort Hausbriefkasten platzte mir die Hutschnur, zumindest wenn das die Sehne ist, die normalerweise den Mittelfinger der rechten Hand in entspannter Pose hält. Aber plötzlich „Peng“, mein Mittelfinger schnellte hoch und ich war ernsthaft innerlich zerzaust und benutzte ein wenig meines Unflatvokabulars. Als ob man versuchte, einen isoliert lebenden Kettenhund mit einem bunten Ball abzulenken, warf man mir erneut „Abteilungsleiter“ hin.
Ich polterte: „Sie können doch nicht zu mir sagen: Sie finden also, Ihr Arsch brennt? Wenn er in drei Tagen noch brennt, dann rufen wir den Feuerwehrhauptmann an.“
Doch das können sie, versicherten sie mir und ich solle in drei Tagen nochmal anrufen.
Ich schlief mit Telefonhörer am Kopf, um morgens gleich die Erste zu sein. War ich auch. Kleine Erfolgserlebnisse wurden zunehmend wichtig für mich. Ein Fax von mir sei aber nicht da. Und ich solle außerdem alle alle alle Ausgaben noch mal in eine Tabelle schreiben, die sie sich ausgedacht haben, sortiert nach Wörter mit R, Wörter mit mehr als sieben Buchstaben, Ausgaben über einem Euro, Ausgaben, die ich an geraden Tagen getätigt habe und dann alles in den Reißwolf und bitte wieder zusammenkleben.
Papiere gingen hin und her, aber nicht diese Papiere, die wir als Geld benutzen.
Whahahaha, weinte ich mich in eine Weinmeditation. Kam geläutert als besserer Mensch zurück, nur war das letzte Hemd nass.
*
Ich hatte keine Erleuchtung, aber eine Vision: Eines Tages werden die Bäume ihre Wurzeln aus der Erde ziehen, in Brandenburg, im Speckgürtel von Berlin, im Stadtpark, an der Kastanienallee, unter den Linden und sie werden zu Tausenden die Straßen entlanggehen, Wurzelschritt für Wurzelschritt, still hintereinander, an einigen Kreuzungen werden sie sich aufteilen und dann weitermarschieren zu den Jobcentern der Stadt. Sie haben seit Jahrtausenden nicht mehr gesprochen, aber jetzt werden sie mit ihren Ästen auf den Tisch hauen und sie werden sagen: HÖRT AUF mit diesen Mahnungen, diesen Aufforderungen und dreifachen Kopien, diesen Nachweisen und Vorladungen. Hört auf. Ihr zerstört Mensch und Baum und Freude und Zeit.
Es muss ein Ende haben. Ihr sollt froh sein und wir wollen leben. Und ihr doch auch. Dazu seid ihr da. Habt ihr das vergessen?
Und als die Bäume gerade durch die Eingangstür wollen, kommt ein Mitarbeiter des Jobcenters und sagt: Vorschrift 123b/irgendwas. Ziehen Sie eine Nummer, sagt er zu allen Bäumen, den Eichen und Pappeln und Birken. Hier wird nicht reingewurzelt und philosophisch getan. Und nehmen Sie ihre Krone ab, sonst zerstören Sie unsere Leuchtstoffröhren.
Also nehmen die Bäume ihre Kronen ab.
Und schweigen ab nun wieder.
In dieser Zeit, spielte ich noch zweimal „Ich packe meine Unterlagen und gehe zum Jobcenter“.
Ich gehe zum Jobcenter und packe meine fehlenden Unterlagen und eine Zwiebel ein.
Ich gehe zum Jobcenter und packe meine fehlenden Unterlagen, eine Zwiebel und ein Messer ein.
Ich setzte mich ins Wartezimmer, ziehe eine Nummer, schneide Zwiebeln und weine.
Oder ich weiß nicht … was könnte man mit einem Messer noch machen?
Bis ich Geld bekam, verging genau das halbe Jahr, für das ich Unterstützung benötigte. Ich konnte am Ende also geradeso das Geld zurückgeben, dass ich mir zusammengeborgt hatte.
Das Leben ist rätselhaft und groß und klein.
Ich stelle mir vor, ich hätte diese ganze Jobcenterodyssee erlebt ohne Beruf, ohne Aussicht darauf, dass es bald finanziell wieder besser läuft, mit weniger oder gar keinen Deutschkenntnissen, vielleicht ganz allein, eventuell krank, mit einem Kind mehr oder zwei und ohne den Trost, am Ende wenigstens drüber schreiben zu können.
Wie mag das sein?
Und wenn es um etwas viel Schlimmeres gehen würde? Um Krieg und Flucht, um Essen und Leid? Und dann diese Vertrösterei?
 Wenn ein Mensch gezwungen ist, um Hilfe zu bitten, dann ist das unangenehm genug. Wenn alle Menschen, die um Hilfe bitten, sehr ausführlich nachweisen müssen, dass sie berechtigt sind, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, dann sollte das Miteinander freundlich und menschenwürdig sein. Sonst gerät der hilfesuchende Mensch unter Generalverdacht der Erschleichung. Und es ist nicht in Ordnung, es hilfesuchenden Menschen so schwer wie möglich zu machen, in der Hoffnung, dass einige die Hoffnung verlieren, aufgeben, wo anders um Hilfe fragen, sich dumm fühlen oder glauben, dass sie kein Recht auf die Hilfe haben.
Wenn ein Mensch gezwungen ist, um Hilfe zu bitten, dann ist das unangenehm genug. Wenn alle Menschen, die um Hilfe bitten, sehr ausführlich nachweisen müssen, dass sie berechtigt sind, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, dann sollte das Miteinander freundlich und menschenwürdig sein. Sonst gerät der hilfesuchende Mensch unter Generalverdacht der Erschleichung. Und es ist nicht in Ordnung, es hilfesuchenden Menschen so schwer wie möglich zu machen, in der Hoffnung, dass einige die Hoffnung verlieren, aufgeben, wo anders um Hilfe fragen, sich dumm fühlen oder glauben, dass sie kein Recht auf die Hilfe haben.
Schnelle Hilfe hilft dreimal so vielen Menschen und das in der gleichen Zeit wie diese zögerliche Hilfe, bei der viel zu viel Geld und Kraft in Organisationskram versinkt.
Und das Tolle ist, dass jetzt gerade politisch gesehen, weltweit, alle gebraucht werden, um zu helfen. Es ist genug Arbeit da.
Auch ohne Jobcenter.
Nur Geld nicht.
Das Geld wollen nicht die Armen und es steht ihnen nicht zu.
Es haben die Reichen und es steht ihnen nicht zu.
Ich habe keinen Schluss.
Es ist ja auch nicht vorbei. Für mich vielleicht, aber für andere nicht.
Foto: Lena Grüber