Die Grande Dame der Frühpädagogik, Ilse Wehrmann, hat ein Buch zur Lage des Kita-Systems geschrieben. Warum? Und was sind die Kernbotschaften? Was tut not? Weiter lesen…
Die Kita-Fachkräfteverbände in Deutschland fordern einen Kita-Gipfel, um einen drohenden Kita-Kollaps abzuwenden. Es brauche endlich eine ehrliche Analyse der Ursachen für die vielfältigen Probleme im Kita-Bereich und einen entschlossenen politischen Willen, bessere Rahmenbedingungen zu etablieren. Das Kita-System müsse auf neue tragfähige Füße gestellt werden und die Praxis mit ihrer Alltagsexpertise beteiligt werden. Weitere Qualitätsverluste seien im Sinne von Kindern und Fachkräften nicht zu verantworten. Die Vertreterinnen von 10 Fachkräfteverbänden schreiben:
Wie verlief die Bundestagsdebatte zur Misere der Kitas?
Fachkräfte im Burnout, verzweifelte Familien:
Im Bundestag herrschte am 9. Februar 2023 Einigkeit, dass es im System Kita nicht weitergehen kann wie bisher. Doch was muss passieren?
Zur Misere der Kindertagesbetreuung debattierte am 9. Februar 2023 der Bundestag auf Initiative der Linksfraktion in einer Aktuellen Stunde. Dietmar Bartsch, Co-Vorsitzender der Linksfraktion, schilderte die Lage zu Beginn mit drastischen Worten. „Wir laufen in eine Katastrophe“, sagte er. Es fehlten 380.000 Betreuungsplätze sowie mindestens 100.000 Erzieherinnen und Erzieher. Keine andere Berufsgruppe erkranke so oft an Burnout.

Seit zehn Jahren gebe es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz, der sei aber „oft ein Papiertiger, der Familien in die Verzweiflung treibt“. Träger und Kommunen würden gezwungenermaßen Betreuungszeiten „einstampfen“. Ein Vollzeitjob oder Schichtarbeit werde so für Eltern unmöglich. Das sei „familienfeindlich ohne Ende“ und „real existierender Anti-Feminismus“.
„Was macht denn eigentlich so ihr Ministerium?“, fragte er an die Adresse von Ekin Deligöz (Grüne), parlamentarische Staatssekretärin im Familienministerium auf der Regierungsbank. Die konnte später selbst erwidern. Es gehe darum, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, sagte sie. Thema der Debatte war auch das Kita-Qualitätsgesetz, mit dem die Bundesländer unter bestimmten Voraussetzungen auch künftig Geld in Beitragssenkungen stecken können. Ihr wäre es lieber gewesen, wenn alles Geld in die Qualität geflossen wäre, sagte Deligöz. Das war allerdings mit den Ländern nicht zu machen.
Deligöz forderte, wie auch andere Rednerinnen und Redner, den Wegfall von Schulgeld an allen pädagogischen Ausbildungsschulen. „Jede einzelne Person in der Branche der frühkindlichen Bildung ist systemrelevant“, sagte sie. Es gebe dort 860.000 Beschäftigte – mehr als in der Automobilbranche. In Richtung der Unionsfraktion sagte die Staatssekretärin: „Die Lage war schon immer ernst, nur Sie haben sich bisher weggedrückt, und nun wachen Sie auf.“
Jede einzelne Person in der Branche der frühkindlichen Bildung ist systemrelevant.
Ekin Deligöz, parlamentarische Staatssekretärin
Zuvor hatte die CDU-Abgeordnete und Familienpolitikerin Silvia Breher gesagt, sie frage sich, warum die Regierung nicht endlich handele. Es fehle an einer Gesamtstrategie und an einem Investitionsprogramm für neue Betreuungsplätze. Die oft genannten vier Milliarden Euro für das Kita-Qualitätsgesetz seien die „Mogelpackung des Jahres“, weil dafür zum Beispiel andere Bundesprogramme gestrichen worden seien.
Dem Appell für mehr Geld schloss sich die SPD-Abgeordnete Carolin Wagner an und richtete ihn an Finanzminister Christian Lindner (FDP). Sie unterstütze aus tiefstem Herzens Saskia Eskens Vorschlag für ein Sondervermögen Bildung. Wagner rief Lindner auf, sich überzeugen zu lassen.
Mogelpackung des Jahres
Silvia Breher (CDU) über das Kita-Qualitätsgesetz
Matthias Seestern-Pauly, FDP-Familienpolitiker, sagte, der Fachkräftemangel komme in den Kitas an. Das System laufe, „wenn wir ehrlich sind, seit Jahren über dem Limit“. Es sei ein großer Fehler der früheren Großen Koalition gewesen, überhaupt mit Bundesgeld pauschale Beitragssenkungen zu finanzieren. Dies wurde durch das Gute-Kita-Gesetz ermöglicht und wird nun im Kita-Qualitätsgesetz in verringerter Form weitergeführt. „So wurde wertvolle Zeit verschenkt“, sagte Seestern-Pauly. „Bund und Länder müssen Fachkräftemangel als absolute Priorität behandeln“, sagte Seestern-Pauly. „Wir, der Bund, tun das bereits.“
Seit Jahren über dem Limit
Matthias Seestern-Pauly, FDP-Familienpolitiker, über das deutsche Kita-System
Die Linken-Abgeordnete Heidi Reichinnek urteilte trotzdem, die Regierung tue viel zu wenig. Sie forderte einen Kita-Gipfel und außerdem kreative Ideen wie eine Rückkehrprämie für Fachkräfte, die den Beruf verlassen haben, sowie eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich für Erzieherinnen und Erzieher.
Mehr echtes, konstruktives Engagement der Opposition forderte die grüne Familienpolitikerin Nina Stahr. „Diese Haltung, liebe Regierung, macht mal, das ist mir echt zu wenig“, sagte sie an die Adresse von Unions- und Linksfraktion. Viele der Rednerinnen und Redner waren sich zumindest einig, der Bund dürfe sich nicht mit Verweis auf die Zuständigkeit der Länder vor dem Thema drücken. Am Ende sei es auch eine Frage der ökonomischen Vernunft, genügend Betreuungsplätze zu schaffen, sagte gegen Ende der Debatte die grüne Parteichefin und Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang. Und außerdem seien Kitas „der Ort in unserem Land, an dem über Chancen und Gerechtigkeit entschieden wird“.
Mit freundlicher Genehmigung: Verlag Der Tagesspiegel GmbH
Text: Karin Christmann/ Der Tagesspiegel
Foto: Markus Spiske / Photocase
Karin Christmann ist Verantwortliche Redakteurin im Meinungsressort des Tagesspiegels.
Das „Gute-Kita-Gesetz“ und die Verteilungsgerechtigkeit
Das „Gute-Kita-Gesetz“ hat Folgen für die Länder, die Kitas, die Fachkräfte, die Eltern und Kinder. Zwar werden die Vereinbarungen über die Verteilung der Mittel zwischen den Ländern und dem Bund erst getroffen, aber es ist höchste Zeit, sich auch in der Praxis darüber Gedanken zu machen und die Dinge nicht allein den politisch Verantwortlichen zu überlassen.
Im wamiki-Gespräch schildert Toren Christians, stellvertretender Personalratsvorsitzender von KiTa Bremen, wie man die Mittel verteilen müsste und welchen Einrichtungen sie warum vor allem zugute kommen müssten.

Welche Überlegungen gibt es in Bremen über die Verteilung der Mittel aus dem „Gute-Kita-Gesetz“?
Gegenwärtig werden bei uns zwei Wege beschritten, auf denen die Mittel verteilt werden sollen. Der eine Weg ist: In einem Qualitätskreis, geführt von der Senatorin für Bildung, erarbeiten Trägervertreter und wir als Gewerkschaft ver.di Qualitätskriterien, die für alle Träger in Bremen und Bremerhaven gelten sollen, verständigen uns über Qualitätsziele und gucken, was geht. Über Geld wurde in diesem Kreis bisher noch nicht geredet, sondern pädagogisch-fachlich diskutiert.
Der zweite Weg, den ich neulich in einer Vorlage zum Jugendhilfeausschuss entdeckt habe: Es geht darum, die Elternbeiträge für die drei- bis sechsjährigen Kinder freizustellen. Das soll zum Sommer wirksam werden, und es wird darauf hingewiesen, wie viel Geld das „Gute-Kita-Gesetz“ in den nächsten Monaten und Jahren bringt. Es entsteht der Eindruck, dass die Option besteht, die Elternbeitragsfreistellung gegen zu finanzieren. Damit wäre das Geld aber weg. Das Land Bremen müsste dann, um die Elternbeiträge für die Drei- bis Sechsjährigen freizustellen, zirka 300 000 Euro selbst zahlen. Der Rest würde über das Gesetz finanziert.
Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt die Beitragsfreiheit?
 Die Beitragsfreiheit wurde in Bremen schon im vorigen Jahr beschlossen. Jetzt wird in den Vorlagen zur gesetzlichen Umsetzung unter anderem die Summe aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ angeführt – als eine Option und immer unter dem Vorbehalt, dass unklar ist, wie viel das letztlich ausmacht, weil die Vereinbarung mit dem Bund ja noch aussteht.
Die Beitragsfreiheit wurde in Bremen schon im vorigen Jahr beschlossen. Jetzt wird in den Vorlagen zur gesetzlichen Umsetzung unter anderem die Summe aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ angeführt – als eine Option und immer unter dem Vorbehalt, dass unklar ist, wie viel das letztlich ausmacht, weil die Vereinbarung mit dem Bund ja noch aussteht.
Die Beitragsfreiheit wurde in Bremen unabhängig vom „Gute-Kita-Gesetz“ beschlossen?
Ja. Aber man ging damals von ganz anderen Summen aus. Die jetzige Summe ist viel geringer als das, was von den Landesministern verabredet war. 1 Was jetzt für die Gesamtlaufzeit beschlossen wurde, war vorher für ein Jahr vorgeschlagen.
Der Jugendhilfeausschuss will umsetzen, was mal beschlossen wurde, und freut sich nun, dass es zusätzliches Geld gibt. Die Senatorin gibt die Analyse des Ist-Zustands in Auftrag und bestimmt Kriterien für das…
… was man fachlich weiterentwickeln will. Die Senatorin gehört dem Jugendhilfeausschuss an.
Und was hat der Qualitätskreis zu sagen?
Er arbeitet die qualitativen Anforderungen und gegebenenfalls den Finanzierungsbedarf für die Mittel aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ aus. Das ist eine komplizierte Sache. Denn wer sagt, dass er die Qualität in einem Bundesland steigern will, hat es mit unterschiedlichen Kommunen zu tun. Er müsste also wissen, welche Qualität er an welcher Stelle steigern will und wie man Qualität bemisst. Zwischen den verschiedenen Trägern existieren aber riesige Unterschiede: Ein Kollege vertritt 30 Kitas der Stadt Bremerhaven. Zu dem Betrieb, in dem ich Personalrat bin, gehören 75 Kitas. Einige Sprecher von Elternvereinen und -initiativen sind für kleine Einrichtungen oder Krabbelgruppen zuständig. Angesichts dieser Vielfalt lässt sich Qualität nur schwer bemessen. Aber es ist richtig, dass ein offener Dialog darüber geführt wird.
Gibt es einen Zeitplan für das weitere Vorgehen?
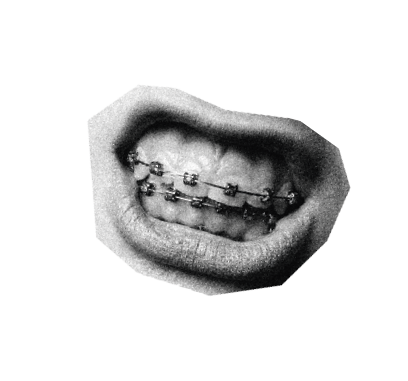 Es gibt keinen offiziellen End-Zeitpunkt, aber den Plan, bis zum Sommer etwas auf dem Papier stehen zu haben. Andererseits: Im Mai haben wir Wahlen in Bremen. Was bis dahin nicht beschlossen ist, muss eventuell neu verhandelt werden, wenn eine andere Partei das Bildungsressort besetzt und neue Leute auf andere Ideen kommen oder andere Schwerpunkte setzen. Von daher: Man muss gucken, was am Ende rauskommt.
Es gibt keinen offiziellen End-Zeitpunkt, aber den Plan, bis zum Sommer etwas auf dem Papier stehen zu haben. Andererseits: Im Mai haben wir Wahlen in Bremen. Was bis dahin nicht beschlossen ist, muss eventuell neu verhandelt werden, wenn eine andere Partei das Bildungsressort besetzt und neue Leute auf andere Ideen kommen oder andere Schwerpunkte setzen. Von daher: Man muss gucken, was am Ende rauskommt.
Wissenschaftlich begleiten Dr. Christa Preissing und Prof. Dr. Susanne Viernickel den Prozess. Deshalb denke ich, dass ein paar gute Orientierungen herauskommen.
Gibt es schon Qualitäts-Kriterien?
Im Moment sind wir beim Sortieren.
Zeichnet sich ein Trend ab?
Ein Trend wäre vielleicht der Versuch, Qualität in einem dialogischen Modell zu entwickeln. Also kein Mess-System wie die KES-Skala oder Ähnliches. Aber ich bin Realist und glaube, am Ende läuft es darauf hinaus: Wie verteilt man die Mittel unter den verschiedenen Trägern so, dass alle etwas damit anfangen können? Geld in dem Umfang für Qualitätssteigerung einzusetzen – das ist eine diffizile Sache. Wo setzt man an?
Das größte Geschenk hat man schon jetzt denjenigen gemacht, die die höchsten Kita-Beiträge zahlen. Kriegen diese Familien einen Anteil, sind sie deutlich entlastet. Aus meiner gewerkschaftlichen und pädagogischen Sicht wäre es aber viel wichtiger, endlich mal etwas für die Kitas an Brennpunkten zu tun.
Was würdest du machen, wenn du für Bremen entscheiden könntest?
Ich würde als erstes versuchen, genau herauszufinden, wie die Besucherstruktur der einzelnen Kitas und Einrichtungen ist. Das heißt: Welchen Bildungshintergrund haben die Eltern? Welchen finanziellen Hintergrund haben sie? Danach würde ich ein Ranking aufstellen. Die Kitas, die am „schlechtesten“ wegkommen, würde ich – vom Gebäude wie vom Personal und allem anderen – so ausstatten, dass Eltern aus anderen Kitas ihre Kinder dort anmelden.
Angesichts der Personalnot und fehlender Kita-Plätze hört sich das geradezu utopisch an.
 Der Mangel an Kita-Plätzen ist relativ. Schraubt man das Angebot immer weiter hoch und sagt: Ihr könnt noch mehr erwarten, noch längere Betreuungszeiten in Anspruch nehmen und jetzt auch noch kostenfrei, dann liegt die Nachfrage bei fast 100 Prozent. Das ist nicht mehr zu erfüllen, wenn man so viele Jahre lang verpennt hat, genügend Fachkräfte auszubilden.
Der Mangel an Kita-Plätzen ist relativ. Schraubt man das Angebot immer weiter hoch und sagt: Ihr könnt noch mehr erwarten, noch längere Betreuungszeiten in Anspruch nehmen und jetzt auch noch kostenfrei, dann liegt die Nachfrage bei fast 100 Prozent. Das ist nicht mehr zu erfüllen, wenn man so viele Jahre lang verpennt hat, genügend Fachkräfte auszubilden.
Vielleicht muss man an der einen oder anderen Stelle mal sagen: Okay, wir sind politisch mit unseren Versprechen über das Ziel hinausgeschossen, müssen einen Schritt zurückgehen und eingestehen, dass wir die Betriebsmittel im Moment nicht haben. Doch das ist nicht populär.
Ganz platt: Will man qualitativ gut arbeiten, braucht man gut ausgebildete Fachkräfte. Aber zu Beginn des letzten Kita-Jahrs fehlte in jeder Bremer Einrichtung durchschnittlich eine Erzieherin. Das summiert sich übers Jahr. Deshalb müsste man einen Schnitt machen und sagen: Wir versprechen den Eltern und der Öffentlichkeit nicht mehr, dass es viel toller wird, sondern nehmen das Geld, das da ist, zum Konsolidieren.
Guckt man sich allein die bauliche Situation der Einrichtungen in einer Stadt wie Bremen an: Es gibt Kitas, die sind „Sanierungsfälle“, und andere, die im Ausbau-Programm berücksichtigt wurden und schon fast den Vorstellungen entsprechen, die eine Erzieherin von ihrem Arbeitsplatz hat. Die Realität ist aber, dass einige Einrichtungen nicht mal über Pausen- und Mitarbeiterräume verfügen. Von großer Wertschätzung der Fachkräfte zeugt das nicht.
Schaue ich mir andere Betriebe und deren Pausenräume an: Es gibt eine Kantine für die Mitarbeiterschaft, angemessene Büros. Eine Erzieherin hingegen hat oft nicht mal Platz für ihre Unterlagen, gar nichts. Wo bereitet sie sich vor, wenn sie acht Stunden für eine Gruppe zuständig ist? Das Haus brummt, es gibt keinen ruhigen Ort für sie, keinen Internetzugang. Jedenfalls ist das nicht Standard, sondern eher die Ausnahme.
Will man von Bildungs- und Sozialarbeit sprechen, müsste eine Kita mit 20, 30 pädagogischen Fachkräften Räume haben, in denen Erzieherinnen sein können, wenn sie nicht mit den Kindern arbeiten. Jede Schule hat ein Lehrerzimmer. Ganz normal! Diesen Standard gibt es in Kitas bei weitem nicht.
Und schon gar nicht in Brennpunkt-Kitas.
Ich glaube, die einzige Möglichkeit besteht darin, eine gesellschaftliche Mischung herzustellen. Wir müssen in den Stadtteilen, in denen die Kinder es am schwersten haben, die Einrichtungen so attraktiv machen, dass mobilere Familien, die für ihre Kinder etwas Besseres wünschen, sie dort hinbringen.
Viele Menschen wissen überhaupt nicht, was das Leben in Armut für Kinder heißt, deren Mütter und Väter ihre Pflichten aufgrund ihrer Belastungen nicht so wahrnehmen können, wie wir denken, dass Eltern das tun müssen.
Wie kann das gelingen?
Man müsste die Mittel nach folgendem Kriterium verteilen: Welche Länder haben die meisten Bedarfe hinsichtlich des Durchschnittseinkommens und des durchschnittlichen Bildungsstandes der Bevölkerung? Diese Länder müssten das Geld dann auf ihre ärmsten Kommunen verteilen. Ein Bundesland wie Bayern könnte demnach nicht so viel Geld nach München schicken, wie München, eine relativ reiche Kommune, anteilig Einwohner hat. Also würden andere Kommunen berücksichtigt werden. Für die politisch Verantwortlichen wäre das ein komplettes Umdenken und würde zu einer ganz anderen Verteilung von Mitteln führen.
Solch ein politisches Handeln würde wahrscheinlich vielen Menschen viel mehr imponieren als Versprechungen, von denen die meisten vermuten: Wird sowieso nichts draus.
 Stimmt. Aber das müsste sich jemand trauen. Es wäre nämlich ein Handeln – und zwar von jeder Partei, die im Bundestag sitzt – gegen die eigene Klientel, die eigene Wählerschaft.
Stimmt. Aber das müsste sich jemand trauen. Es wäre nämlich ein Handeln – und zwar von jeder Partei, die im Bundestag sitzt – gegen die eigene Klientel, die eigene Wählerschaft.
An Wahlen beteiligt sich ja nur noch die Hälfte der Bevölkerung. In Stadtteilen, in denen es den Leuten besonders schlecht geht, liegt die Wahlbeteiligung bei 20 Prozent. Das heißt: Wer sich das traut, würde diejenigen, die zur Wahl gehen und ihm ihre Stimme geben, vor den Kopf stoßen, weil er denen etwas gibt, die ihn nicht gewählt haben.
Deshalb ist die Beitragsbefreiung so populär. So etwas bringt Wählerstimmen. Bei den Leuten, die Geld haben, schlägt sie am meisten zu Buche. Bei den Familien, die schon Zuschüsse bekommen, nicht.
Ich sehe das bei meiner Tochter. Natürlich freut sie sich darüber, dass jetzt in Niedersachsen Beitragsfreiheit herrscht und sie ihr Haus deutlich schneller abzahlen kann. Das kann ich nachvollziehen. Gekauft hatte sie das Haus aber vor dem Beschluss der Beitragsfreiheit und könnte es anders abzahlen.
Noch mal zurück zum Thema „Personal“ und dem Fachkräftemangel. Wie sieht es damit in Bremen aus?
Weil die Kolleginnen und Kollegen daran interessiert sind, dass es den Kindern gut geht, wird der Mangel überdeckt. Die Fachkräfte tun mehr, als ihnen gut tut. Das führt dazu, dass engagierte Kolleginnen und Kollegen, die schon lange im Beruf sind, krank werden und ausfallen. Die Krankheitsraten bei Erzieherinnen und Erziehern sind in den letzten Jahren astronomisch gestiegen – eine Auswirkung des Fachkräftemangels. Die andere Auswirkung: Ältere Kolleginnen halten den Stress nicht bis zur Rente aus und flüchten sich in Teilzeit.
Berufseinsteigerinnen hingegen kriegen heute sofort unbefristete Verträge und können bis zu 39 Stunden arbeiten. Manche sagen aber: So heftig brauche ich das nicht; ich komme mit dem Geld für 30 Stunden aus und arbeite Teilzeit. Trotz des Fachkräftemangels hat sich die Teilzeitquote in unserem Bereich kaum verändert. Das heißt: Wer kann, flüchtet sich in Teilzeit oder Nebenjobs, weil das Geld doch gebraucht wird, denn in der Kita ist der Druck zu hoch, und es kommt zu Überforderungen.
Ein Beispiel: Eine Kollegin, die mehr als 20 Jahre in einer Einrichtung arbeitet, reagiert in einer Stresssituation über und hält einem Kind die Hände fest, das rumkaspert. Obwohl die Frau weiß, das ihr Handeln nicht richtig ist, kommt es zu einem Gespräch mit der Fachberaterin, die ihr einen Vortrag hält und sie auffordert, an ihrer „Haltung“ zu arbeiten. Fast hätte es eine Abmahnung gegeben. Ich finde: Nicht die Erzieherin ist schuld – angesichts der druckvollen Bedingungen, die in ihrer Kita herrschen. Ganz andere Leute haben das zu verantworten.
Schlimm ist auch, dass erfahrene Kolleginnen aus dem Beruf aussteigen, weil sie die Arbeitsweise, zu der sie angesichts des Mangels gezwungen sind, nicht mehr mit ihrem Berufsanspruch vereinbaren können.
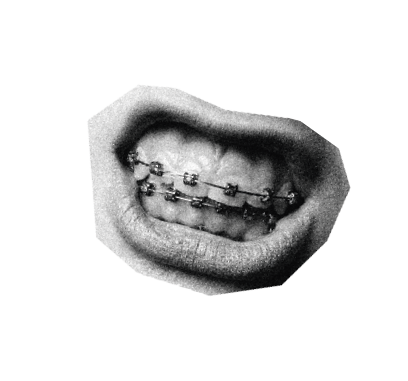 Eine andere Variante dieses Problems: Aus dem Umland kommen Erzieherinnen, die in ihren Wohnorten auch gern gesehen sind, zur Arbeit nach Bremen. Zunehmend entscheiden sie sich, in der beschaulichen Umlandgemeinde zu bleiben, und haben auf einen Schlag eine Elternschaft, die sie nicht in allen Großstadt-Ortsteilen geboten kriegen. Sie haben kurze Arbeitswege, die Einrichtungen und ihre Außengelände sind schöner, und teilweise werden sogar Zulagen auf den Tarif bezahlt. Inzwischen haben wir regelmäßig Kündigungen von Kolleginnen, die sich ins Umland flüchten. Viel mehr als früher. Im Prinzip ist das eine Art Umverteilung: Engagierte Kolleginnen und Kollegen gehen dorthin, wo es den Menschen besser geht.
Eine andere Variante dieses Problems: Aus dem Umland kommen Erzieherinnen, die in ihren Wohnorten auch gern gesehen sind, zur Arbeit nach Bremen. Zunehmend entscheiden sie sich, in der beschaulichen Umlandgemeinde zu bleiben, und haben auf einen Schlag eine Elternschaft, die sie nicht in allen Großstadt-Ortsteilen geboten kriegen. Sie haben kurze Arbeitswege, die Einrichtungen und ihre Außengelände sind schöner, und teilweise werden sogar Zulagen auf den Tarif bezahlt. Inzwischen haben wir regelmäßig Kündigungen von Kolleginnen, die sich ins Umland flüchten. Viel mehr als früher. Im Prinzip ist das eine Art Umverteilung: Engagierte Kolleginnen und Kollegen gehen dorthin, wo es den Menschen besser geht.
In Bremen versucht ver.di gerade, mit den Arbeitgebern eine Tarifregelung festzulegen, die den Fachkräften, die in schwierigen Kitas arbeiten, ihren höheren Aufwand entgeltet – nach Sozialindex verteilt. Trotzdem wandern welche auf die andere Seite der Stadtgrenze ab.
All das müsste sich in den Analysen, die jetzt gefordert sind, niederschlagen.
Nein, das spielt überhaupt keine Rolle, wird nicht berücksichtigt. Man will nicht wirklich umsteuern, nichts umstellen. Die Verteilung der Mittel aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ läuft pro Kopf der Bevölkerung. Danach ist das Kind eines Millionärs dem Kind einer Familie mit Sozialhilfe gleichgesetzt.
Also geht es letztlich darum, die bestehenden Verhältnisse abzusichern und nicht zu verändern. Was ist dein worst-case-Szenario, Toren?
Aus meiner Rolle und Funktion heraus ist mein worst-case-Szenario, dass genau an den prekären Stellen demnächst unausgebildete und schlecht ausgebildete Menschen eingesetzt werden, um die Betreuungszeiten zu sichern. Wir erleben jetzt schon, dass wegen fehlenden Personals mit den Eltern für bestimmte Zeiten Vereinbarungen getroffen werden, den vollen Betreuungsumfang, den sie zu Beginn des Kindergartenjahres zugesichert bekamen, nicht mehr in Anspruch zu nehmen. All das trifft wieder die Familien, die wir eigentlich besser stellen müssten.
Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind, können ihre Kinder bis 16.00 Uhr in der Kita lassen. Sitzen Mutter oder Vater zu Hause, steht ihnen nur eine Betreuungszeit bis 12.00 oder 13.00 Uhr zu. Das besser ausgebildete Personal wird dann in den Bis-16.00 Uhr-Gruppen eingesetzt. Das notausgebildete Personal ist für die Kinder in den Kurzzeit-Gruppen zuständig, deren Eltern wahrscheinlich nicht aufmucken.
Wenn in einer Kita mal was schief läuft, landet sie schnell in der Zeitung. In vielen Kitas, die die Betreuung in den letzten Jahren aufgrund Personalmangels nicht sichern konnten, sorgten Eltern dafür, dass die Presse das brachte: Betreuung unsicher, mehr Not- als Regeldienst und, und, und…
Es gab in diesem Zusammenhang eine Selbstanzeige eines Kita-Trägers „Fröbel“ in Brandenburg. Wie reagieren die Träger in Bremen auf solche Notlagen?
 Unsere Geschäftsführung ist direkt der Senatorin unterstellt. Deshalb darf unser Träger wie alle staatlichen Betriebe nicht mit einer Selbstanzeige reagieren. Private Träger können das tun.
Unsere Geschäftsführung ist direkt der Senatorin unterstellt. Deshalb darf unser Träger wie alle staatlichen Betriebe nicht mit einer Selbstanzeige reagieren. Private Träger können das tun.
Unser Träger reagiert, indem er versucht, personelle Aufstockungen in schwierigen Situationen vorzunehmen. Immer dort, wo der öffentliche Druck hoch ist, genehmigt der Träger für die betroffene Kita eine Sonderausstattung. Plötzlich kriegt die Leitung 15 Stunden mehr, um die Situation besser managen zu können, damit ihre Kita nicht mehr in der Zeitung steht.
Und woanders werden die Löcher größer.
Sie bleiben bestehen oder reißen auf.
Das ist, als ob man immer mehr Schulden macht und eigentlich Insolvenz anmelden müsste. Wenn die Rahmenbedingungen so schlecht sind, dass die Arbeit nicht mehr geschafft werden kann, erhebt sich die Frage, ob man weitermachen oder sagen muss: Es geht nicht mehr!
Die politisch Verantwortlichen müssten eingestehen: Wir haben mit dem, was wir versprochen haben, überzogen und müssen zurückrudern. Wir brauchen jetzt fünf oder zehn Jahre lang noch mehr Geld, um weniger zu machen. Jedenfalls so lange, bis genügend Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet sind.
Stellt euch vor, ihr habt eine Reise geplant und sitzt im Flieger. Die Türen werden geschlossen, das Flugzeug rollt auf die Startbahn, und der Pilot hält seine Ansprache: „Das Wetter ist gut, unsere Triebwerke sind frisch gewartet. Das hat eine umgeschulte Fachkraft gemacht, die bisher im Kindergarten beschäftigt war. In 160 Stunden hat sie das gelernt.“ Ich wette, dass ganz viele Leute sofort aussteigen wollen. Aber in der Kita kann man so was machen.
Wo und wie kann man denn jetzt noch Druck machen – zum Beispiel in Bremen?
Wenn die Haushalte fürs nächste Jahr beschlossen werden, müssten die Analysen fertig sein. Schon vor der Planung der Haushalte muss man den Finger in die Wunde legen und denjenigen, die die Gelder wahrscheinlich falsch lenken, wenigstens die Peinlichkeit ihres Handelns deutlich machen.
Ich bin mittlerweile Realist genug, um zu sagen, dass man nicht umsteuern kann. Doch wir können Fragen stellen und Erklärungen fordern, was mit den Geldern warum passiert. In Bremen und überall.
Welche Fragen könnten das sein?
 Dafür gibt es kein Rezept. Aber es hilft immer, so viele politische Verantwortungsträger anzusprechen, wie man erwischen kann. Im Stadtteil kann man den Stadtteilbeiratssprecher oder den Vertreter der Opposition fragen, wie er sich die Verteilung der Mittel vorstellt. Trifft man auf einer anderen Ebene jemanden, der politische Verantwortung trägt, kann man ihn fragen, wie es sein kann, dass es so ist, wie es ist.
Dafür gibt es kein Rezept. Aber es hilft immer, so viele politische Verantwortungsträger anzusprechen, wie man erwischen kann. Im Stadtteil kann man den Stadtteilbeiratssprecher oder den Vertreter der Opposition fragen, wie er sich die Verteilung der Mittel vorstellt. Trifft man auf einer anderen Ebene jemanden, der politische Verantwortung trägt, kann man ihn fragen, wie es sein kann, dass es so ist, wie es ist.
In Bremen laden wir unsere Landesministerin zu einer Personalversammlung ein – vor den Wahlen. Die Kolleginnen und Kollegen werden sie fragen, was sie denn mit dem Geld machen will, das sie kriegt. Ich finde, dass Fachkräfte, die unter Druck stehen, die treffendsten Fragen stellen und die politisch Verantwortlichen in größte Erklärungsnot bringen können.
Das Leitmotiv der Bundesministerin Giffey ist: Damit es jedes Kind packt. Dafür macht sie die Gesetze, sagt sie.
Ja, das ist gut gemeint. Man muss den Politikerinnen und Politikern aber erklären, was es für Auswirkungen hat. Das sehen sie nicht mehr. Dazu sind sie zu weit weg. Deshalb ist es so wichtig, dass die Fachkräfte, die Erzieherinnen und Erzieher, nicht versuchen, alles mit sich selbst und in ihren Einrichtungen auszumachen, sondern diejenigen einladen, die die Verantwortung für die Zustände tragen, und ihnen erklären, was Sache ist.
Neulich erzählte eine Kita-Leiterin am Telefon: „Viele Kolleginnen beschweren sich. Aber es hilft ja nichts. Ich bleibe lieber positiv eingestellt und versuche, das zu machen, was geht. Denn am Ende landet ja alles auf dem Rücken der Kinder…“
Das ist ein klassisches Phänomen in der Branche. Viele Fachkräfte agieren nicht politisch, sondern subjektivieren die belämmerte Situation: Ich bin verantwortlich und muss retten, was zu retten ist. Bin ich schlecht gestimmt, dann bin ich selbst schuld. Habe ich die richtige „Haltung“, wird es schon gehen. Es liegt an mir, nicht an den Bedingungen. So ist es aber nicht. Es wird sich nichts verändern, wenn alle denken: Ich regle das mit meinem Team oder zur Not allein.
Gegen das Gefühl des Allein-gelassen-Seins hilft Austausch: In jedem Bundesland geraten die Fachkräfte ans Limit. Und immer aus den gleichen Gründen.
Wenn sie erfahren, dass es überall so schlecht ist, stecken sie vielleicht die Köpfe in den Sand. Andererseits: Sich Gehör zu verschaffen, das ist schon mal ein Erfolg. Da wächst die Lust, weiterzumachen und nicht nur einzustecken. Man muss aber einen langen Atem haben.
1. Siehe auch: Das Gute-Kita-Gesetz – ein Gesetz des Stillstands. Interview mit Niels Espenhorst. wamiki 1/2019, S. 12ff. ↩
Interview: Erika Berthold, Lena Grüber
Toren Christians ist stellvertretender Personalratsvorsitzender von KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen, und Mitglied im ver.di Bundesfachgruppenvorstand Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe.
Kontakt: toren.christians@kita-bremen.de
10 Fragen an Toren Christians
Wann bist du glücklich?
Wenn meine Enkeltochter zu Besuch kommt.
Was regt dich auf?
Unehrliches Handeln.
Was fällt dir ein, wenn du an deine Kindheit denkst?
Ich war oft im Wald.
Was kannst du von Kindern lernen?
Spontanität und Lächeln.
Wen hättest du gern getroffen?
Richard Wagner.
Was kannst du am besten?
Improvisieren.
Was kannst du überhaupt nicht?
Planvoll handeln.
Auf welchen Gegenstand kannst du verzichten?
Auf eine Smartwatch.
Was wäre für dich eine berufliche Alternative?
Irgendetwas Handwerkliches.
Was wünschst du dir?
Zeit.
Warum er sich nicht wiederholen darf, erklärt Matthias Seestern-Pauly, Bundestagsabgeordneter der FDP, in seinem Gastbeitrag für wamiki.
Wie würden Sie entscheiden?
Es schien so, als wären wir in der öffentlichen Anhörung des Familienausschusses zum sogenannten „Gute-Kita-Gesetz“ nach mehreren Stunden intensiver Befragung der zehn Sachverständigen auf die Zielgerade eingebogen, als es noch einmal spannend wurde.
Die letzte Fragerunde hatte begonnen, da hoben sich sämtliche Blicke und ruhten auf der Phalanx der Sachverständigen, die gemäß der Größe der Bundestagsfraktionen von diesen benannt worden waren, in der Mitte des Ausschussrundes.
Die Frage an alle zehn Experten lautete:
„…Würden Sie in Abwägung aller Argumente, die jetzt auf dem Tisch liegen, uns nahelegen, uns zu enthalten, mit Nein oder mit Ja zu stimmen?“
Was dann folgte, hätte ein Wendepunkt sein können, sogar sein müssen: Neun der zehn geladenen Sachverständigen bekannten in kurzer Folge, dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht zustimmen zu können. Nicht eine positive Stimme fand sich, die dem Gesetzentwurf – abgesehen von dem grundsätzlichen Ziel, die Kita-Qualität verbessern zu wollen – etwas abgewinnen konnte.
Neun Mal ‚Ich würde dem vorliegenden Entwurf nicht zustimmen ‘ – bei einer Enthaltung, da die zehnte Sachverständige von ihrem Verband kein Votum mit auf den Weg bekommen hatte.
Wenn man sich vor Augen führt, dass auch die von Union und SPD benannten Sachverständigen den Gesetzentwurf nicht zustimmungsfähig fanden, stellt sich die Frage: Was war passiert?
Dass wir als Freie Demokraten berechtige Kritik üben, auf Problemstellen hinweisen und auf Verbesserungen hinwirken, ist verständlich. Die engmaschige Kontrolle der Regierung und ihrer Arbeit ist Kernaufgabe guter Oppositionsarbeit. Dass jedoch auch Vertreter von Zivilgesellschaft, Stiftungen und Sozialverbänden ein Gesetz so eindeutig ablehnen, wie das sogenannte „Gute-Kita-Gesetz“, würde normalerweise nur eines bedeuten: zurück ans Reißbrett!
Doch es geschah nichts. Nicht eine der grundlegenden Problemstellen und nicht einer der Kritikpunkte wurde im Nachhinein der öffentlichen Anhörung – wie normalerweise parlamentarischer Usus – durch Änderungsanträge der Regierungskoalition zumindest in Ansätzen korrigiert.
Was, also, war passiert?
 Den Beratungen war ein jahrelanger, gemeinsamer Prozess der Abstimmung zwischen Bund und Ländern vorausgegangen. Jedoch muss festgestellt werden, dass das von Ministerin Giffey vorgelegte Gesetz deutlich von den beschlossenen Eckpunkten der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK 2017) abweicht.
Den Beratungen war ein jahrelanger, gemeinsamer Prozess der Abstimmung zwischen Bund und Ländern vorausgegangen. Jedoch muss festgestellt werden, dass das von Ministerin Giffey vorgelegte Gesetz deutlich von den beschlossenen Eckpunkten der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK 2017) abweicht.
Das ursprüngliche Ziel der JFMK war es, dass der Bund sich verlässlich an den Kosten für den Ausbau der Kita-Qualität beteiligt. Die Bedingung im Gegenzug: Die Finanzmittel müssen zielgerichtet, wie vereinbart, von den Ländern eingesetzt werden.
An diesem Punkt begann der Prozess in den Händen von Familienministern Giffey an drei Stellen zu zerfasern und vom Vereinbarten abzuweichen:
• verlässliche Finanzierungsbeteiligung des
Bundes (über 2022 hinaus),
• klare Vereinbarungen mit den Ländern über
den Einsatz der Mittel,
• anschließende Kontrolle der Mittelverwendung durch bundesweit vergleichbare Qualitätsstandards.
Dieser Dreiklang aus verlässlicher finanzieller Unterstützung des Bundes im Gegenzug für überprüfbare Investitionen der Länder in vorher festgelegte Qualitätsfelder sollte die Basis für dauerhafte und zielgerichtete Verbesserungen der Kita-Qualität sein.
Es kam anders.
Es kam das sogenannte „Gute-Kita-Gesetz“
 Wer verstehen will, wie sich der anfänglich vielversprechende Fahrplan der JFMK zum „Gute-Kita-Gesetz“ verpuppte, der braucht nur diese drei Punkte beleuchten. Doch der Reihe nach.
Wer verstehen will, wie sich der anfänglich vielversprechende Fahrplan der JFMK zum „Gute-Kita-Gesetz“ verpuppte, der braucht nur diese drei Punkte beleuchten. Doch der Reihe nach.
Bildung ist grundsätzlich Ländersache. Das bedeutet zum einen, dass die Länder alleine über die Ausgestaltung der Bildungspolitik entscheiden; es bedeutet aber auch, dass der Bund nur unter strengen Auflagen Geld an die Länder für die Bildung überweisen darf.
Im Falle des sogenannten „Gute-Kita-Gesetzes“ ist „überweisen“ jedoch nur eine Umschreibung. Hier überlässt der Bund den Ländern einen größeren Teil der Einnahmen aus der Umsatzsteuer. So erhalten die Länder ein Teil des Geldes, das dem Bund zugestanden hätte.
Eine solche Umschichtung der Umsatzsteuer darf aber nicht per se an Investitionen in die Bildung geknüpft sein: Daher will der Bund mit jedem Bundesland einen separaten Vertrag über die Verwendung der zusätzlichen Mittel schließen. Aber diese Verträge sind wenig mehr, als Feigenblätter. Denn wenn die Länder sich sodann nicht an die Absprachen der Verträge halten, gibt es keinerlei Sanktionsmöglichkeiten des Bundes. Denn die Mittel aus der Umsatzsteuer dürfen eben nicht zweckgebunden sein. Versuchte der Bund über Sanktionen eine bestimmte Verwendung des Umsatzsteuereinkommens der Länder zu erzwingen, so wären dies „goldene Zügel“, mit denen der Bund die Länder an die Kandare nähme. Und das wäre grundgesetzwidrig.
Um der (ungebundenen) Umsatzsteuerumlage dennoch den Anstrich der Seriosität zu verleihen, sollen also nach dem Willen der Bundesregierung Verträge zwischen Bund und Ländern die Kriterien der Mittelverwendung festlegen. Und zwar ohne jedwede Sanktionsmöglichkeit des Bundes. Grundlage für die Kriterien der Mittelverwendung in den Bund-Länder-Verträgen sind die Handlungsfelder, der „Instrumentenkasten“, des Bundesgesetzes. In diese Handlungsfelder zur Qualitätsverbesserung sollen die Länder das zusätzliche Geld des Bundes investieren.
Und hier findet sich deutlich die Handschrift von Frau Giffey wieder; leider, muss man sagen.
Warum?
 Erstens: Frau Giffey hat sich in den Verhandlungen mit den Ländern über die Ausgestaltung der Handlungsfelder, in die die Länder die zusätzlichen Bundesmittel investieren können, ein Trojanisches Pferd in ihren Gesetzentwurf schreiben lassen: die pauschale Beitragsfreiheit.
Erstens: Frau Giffey hat sich in den Verhandlungen mit den Ländern über die Ausgestaltung der Handlungsfelder, in die die Länder die zusätzlichen Bundesmittel investieren können, ein Trojanisches Pferd in ihren Gesetzentwurf schreiben lassen: die pauschale Beitragsfreiheit.
Vorneweg: Eine soziale Staffelung der Beiträge ist ausdrücklich zu begrüßen und zwar nicht nur für Eltern im Sozialbezug, sondern insbesondere auch für Alleinerziehende und Eltern, für die der Kitabeitrag trotz Berufstätigkeit eine große Belastung darstellt. Kurz: Der Kitabesuch darf nicht am Geldbeutel der Eltern scheitern.
Dass die Länder auf die Beitragsbefreiung für alle als Teil des Instrumentenkastens drängten, ist vor dem Hintergrund teurer Wahlkampfversprechen grundsätzlich nachzuvollziehen, wenngleich man auch diese Intention kritisch hinterfragen muss. Festzustellen ist, dass die Länder sich am Ende durchgesetzt haben. Mehr Geld vom Bund, ohne Auflagen, aber mit dem Feigenblatt der pauschalen Beitragsfreiheit als Teil der Handlungsfelder ist für sie ein Geschenk.
Dieses Ländergeschenk ist aber eben auch schlechte Bundespolitik. Denn wenn es einen verlässlichen finanziellen Ausgleich des Bundes in Milliardenhöhe geben soll, dann muss die Bundesebene auch ein berechtigtes Interesse daran haben, dass die Finanzmittel nachvollziehbar in den dringend benötigten, tatsächlichen Qualitätsausbau fließen – und nicht, wie nun geschehen, ein Großteil der Mittel in der Refinanzierung von Wahlgeschenken versickert.
Denn angesichts des eklatanten Nachholbedarfs bei verbesserten Rahmenbedingungen für Fachkräfte, dem Betreuungsschlüssel, der Sprachförderung, der Entlastung der Kita-Leitungen und des baulichen Investitionsbedarfs für ein gutes Betreuungs- und Arbeitsumfeld in den Kitas ist eine pauschale Beitragsfreiheit zum jetzigen Zeitpunkt kontraproduktiv.
So sollen beispielsweise nach dem Willen der Rot-Schwarzen Landesregierung in Niedersachsen über 80 Prozent der vom Bund für den Qualitätsausbau vorgesehenen Finanzmittel in die Refinanzierung der pauschalen Beitragsfreiheit fließen. Dementsprechend niedrig sind die noch übrigbleibenden Mittel für tatsächliche Qualitätsinvestitionen.
Doch damit nicht genug. Durch dieses Vorgehen geraten die Kommunen sogar doppelt finanziell unter Druck: Denn die Ausgleichzahlungen der Länder reichen oftmals nicht aus, um die durch die pauschale Beitragsfreiheit gerissenen Haushaltslöcher zu stopfen. Eine Kommune, der die Elternbeiträge wegbrechen, fehlt das Geld an allen anderen Ecken und Enden. Die Folge: Die Kommunen müssen zusätzlich eigene Mittel für die Finanzierung der pauschalen Beitragsfreiheit aufwenden, die dann für bessere Rahmenbedingungen in der Bildung vor Ort fehlen.
Und was geschieht erst, wenn die Bundesmittel ab 2023 wieder wegfallen sollten? Kürzen die Länder dann ihre Ausgaben oder führen sie die Elternbeiträge wieder ein?
Zweitens: Selbst die Bundesländer, die die Mittel des Kita-Gesetzes nicht für die pauschale Beitragsfreiheit ausgeben, haben keinen verlässlichen Anreiz, keine Planungssicherheit, um in die wertvollste aller Qualitätsmerkmale zu investieren: gut ausgebildete und bezahlte Fachkräfte. Denn Personalkosten sind Langzeitverpflichtungen. Aber wer investiert in mehr Fachkräfte, wenn nur Geld für die nächsten vier Jahre zur Verfügung steht? Kaum jemand.
Drittens: Selbst die Möglichkeit, in den Bund-Länder-Verträgen zumindest wirkungsvolle Kontrollmechanismen über den Fortschritt bei der Qualitätsentwicklung zu vereinbaren, ist verbaut. Ministerin Giffey hat sich eine Frist bis zum 1. August 2019 gesetzt. Bis dahin müssen mit allen 16 Ländern entsprechende Verträge geschlossen sein. Geschieht dies nicht, können selbst diese Feigenblätter der Kontrolle nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Länder im Einsatz der zusätzlichen Mittel ungebunden sind. Das ist ein gehöriges Pfund, mit dem die Länder in den Vertragsverhandlungen wuchern können.
An dieser Stelle noch einmal zur Erinnerung: Der Dreiklang aus verlässlicher finanzieller Unterstützung des Bundes im Gegenzug für überprüfbare Investitionen der Länder in vorher festgelegte Qualitätsfelder sollte die Basis für dauerhafte und zielgerichtete Verbesserungen der Kita-Qualität sein.
Dies umzusetzen und in einem Konsens zu vereinen, hat Bundesministerin Giffey nicht geschafft.
Was am Ende bleibt ist das Bild einer Ministerin, die ihr Gesicht wahren musste. Dass die Union dem Gesetzentwurf zustimmte, war einzig und allein dem Koalitionsfrieden geschuldet – um die Qualität der Kitas ging es längst nicht mehr. Das wurde von Seiten der Union nicht nur in den Plenardebatten deutlich. Da hilft es auch nicht, wenn der Gesetzentwurf in einer hübschen, wohligen Verpackung steckt („Gute-Kita-Gesetz“), in der Hoffnung, dass die Öffentlichkeit denkt, alles sei Gold, was glänzt. Mitnichten.
Denn das Gesetz heißt offiziell Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz. Das ist zwar kein wohliger Name, aber er macht unmissverständlich klar, worum es eigentlich gehen sollte: Qualitäts- und Teilhabeverbesserungen. Nicht pauschale Beitragsfreiheit im ersten Schritt. Nicht Gelder ohne Vorgaben und mit der Gießkanne für die Länder.
Wie also hätte ein gutes Kita-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz ausgesehen?
 Die pauschale Beitragsfreiheit wäre nicht Bestandteil. Wohlgemerkt: die pauschale Beitragsfreiheit. Denn wenn die Beiträge zu einem Hindernis werden, die Kinderbetreuung überhaupt in Anspruch zu nehmen, ist die Befreiung von Beiträgen in diesen Fällen tatsächlich auch eine Qualitätsverbesserung. Ein wirklich gutes Kita-Gesetz hätte den Einsatz von Bundesmitteln also auf die Gegenfinanzierung einer fairen Sozialstaffel bei den Beiträgen beschränkt – im Interesse der Eltern und Kommunen.
Die pauschale Beitragsfreiheit wäre nicht Bestandteil. Wohlgemerkt: die pauschale Beitragsfreiheit. Denn wenn die Beiträge zu einem Hindernis werden, die Kinderbetreuung überhaupt in Anspruch zu nehmen, ist die Befreiung von Beiträgen in diesen Fällen tatsächlich auch eine Qualitätsverbesserung. Ein wirklich gutes Kita-Gesetz hätte den Einsatz von Bundesmitteln also auf die Gegenfinanzierung einer fairen Sozialstaffel bei den Beiträgen beschränkt – im Interesse der Eltern und Kommunen.
Auch die Kontrolle der Mittelverwendung durch die Länder hätte mit einer wissenschaftlich fundierten Ausgestaltung der Handlungsfelder sichergestellt werden können: Wenn zum Beispiel klare, wissenschaftlich fundierte Zielkorridore für den Fachkraft-Kind-Schlüssel vorgegeben wären, dann ließen sich die Fortschritte in den Ländern auch tatsächlich und objektiv bewerten. Zum Vergleich: Im Gesetz von Ministerin Giffey heißt es lediglich, ein „guter“ Fachkraft-Kind-Schlüssel solle erreicht werden. Wie dehnbar der Begriff „gut“ ist, verdeutlicht sich so nicht nur beim Namen des sogenannten „Gute-Kita-Gesetzes“.
Zu guter Letzt der wohl problematischste Punkt: die fehlende Verstetigung, die fehlende verlässliche finanzielle Beteiligung des Bundes, die auch Personalausgaben nachhaltig ermöglichen würde.
An diesem Punkt ist die Haltung der Freien Demokraten klar: Wir brauchen endlich die Reform des Bildungsföderalismus! Wir können nicht für jedes Gesetz, für jedes Programm erneut zwischen Bund und Ländern ringen. Und für mich und meine Fraktion ist klar: Kitas leisten mehr als bloße Betreuung; Bildung beginnt in der Kita! Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, die es dem Bund erlauben, strukturell in Bildung zu investieren.
Um den Irrsinn des sogenannten „Gute-Kita-Gesetzes“ nicht zu wiederholen, sind diese Rahmenbedingungen unabdingbar. Investitionen in die Zukunft der Bildung, in die Zukunft unserer Kinder, dürfen nicht vom (fehlenden) Verhandlungsgeschick einer Bundesministerin und den Wahlkämpfen in den Ländern abhängen.
Das ist unverantwortlich, unverständlich und zukunftsvergessen.
Denn weltbeste Bildung ist die beste Chancengleichheit – und zwar für alle!
Text: Matthias Seestern-Pauly
zuständig für Kinder und Gedöns oder Erzieherinnen auf der Rutschbahn nach unten
Nach wie vor werden Erziehrinnen und Erzieher nicht in dem Maße anerkannt, wie es diesem Beruf und denen, die ihn ausüben, zukommt. Im Gegenteil!
Im „wamiki“-Gespräch erklärt Dr. Elke Alsago, Referentin des ver.di-Bundesvorstands, welche Strategien der Abwertung bundes- und landesweit erfunden und durchgesetzt werden.

„Wir kümmern uns um die Kümmerer“, sagte Bundesfamilienministerin Giffey und versprach, sich für bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen einzusetzen.
Doch auf „kreativen“ Wegen und leisen Sohlen scheint sich das Gegenteil einzustellen.
Das stimmt, obwohl stets deklariert wird: Wir brauchen die Erzieherinnen und Erzieher, sie sind wichtig, sollen besser bezahlt werden und mehr gesellschaftliche Anerkennung bekommen. Guckt man sich jedoch an, wie die Politik agiert, dann sieht man: Systematisch wird Abwertung betrieben. Dahinter stecken der Ausbau der Kindertagesbetreuung und das Versprechen der ganztätigen Betreuung für Kinder vom ersten Lebensjahr an bis zum Ende der Grundschulzeit.
Nun heißt es: Wir wollen mehr Fachkräfte gewinnen. Es geht aber nicht um Fachkräfte, sondern um Arbeitskräfte. Deshalb wird die Ausbildung verändert. In Mecklenburg-Vorpommern erfand man eine Ausbildung, die sich „Erzieherin von Null bis Zehn“ nennt und vergleichbar mit der Sozialassistentin oder Kinderpflegerin ist. Anerkannt ist dieser Beruf übrigens nur in Mecklenburg-Vorpommern. Als ich dort eine Dame im Ministerium fragte, wie sie das findet, sagte sie: Gut, denn die Frauen sollen ja bei uns bleiben.
Was für ein übler Trick!
Ja. Man legt neue Sackgassen an – typisch für Frauenberufe, in denen die Karriereleiter ganz schnell endet. In diesem Fall geht es um Einengung und Bindung zugleich.
In Niedersachsen und Brandenburg wird Ähnliches diskutiert. Man versucht, die Ausbildung zu verkürzen – auch damit wertet sie man ab –, um mehr Frauen zu gewinnen, die diese Arbeit machen, und sie im Arbeitsfeld zu halten. Sie können dann weder das Bundesland verlassen noch in andere Arbeitsfelder der Jugendhilfe wechseln oder in der Eingliederungshilfe arbeiten. Das ist die eine Strategie.
Die andere Strategie der Länder ist: Sie verändern die Fachkraft-Definition. Jedes Land hat einen Fachkräfte-Katalog, der festlegt, wer als Fachkraft anerkannt ist und in den Einrichtungen arbeiten darf. In den 16 Bundesländern gibt es 16 unterschiedliche Fachkraft-Kataloge, die jetzt geöffnet werden, so dass sich eine Art Flickenteppich mit unterschiedlichen Definitionen ergibt.
Zwar werden Erzieherinnen überall als Fachkräfte anerkannt, aber alles, was sich darunter befindet, alle anderen Berufe oder Abschlüsse werden, was die Arbeit in Kitas anbelangt, unterschiedlich bewertet. Das Land Hamburg – ein Extrem-Beispiel – hat eine „Positiv-Liste“ darüber aufgestellt, wer in der Kita arbeiten darf. Zum Beispiel: Absolventinnen einschlägiger Studienrichtungen. Das geht ja noch. Erlaubt werden aber auch Absolventinnen irgendeines Studiums. Das kann dann eine Ökotrophologin sein oder eine Bauingenieurin. Diese Frauen absolvieren einen 160-Stunden-Kurs und sind danach anerkannte pädagogische Fachkraft für die Kita. Damit macht man den Beruf kaputt. Man fragt nicht mehr, welcher Berufsabschluss notwendig ist, sondern: Wer kann hier arbeiten, wen lassen wir zu?
Ist es völlig egal, wer in der Kita arbeitet?
Ja, auch Erziehungsberechtigte sind im Saarland und in Schleswig-Holstein anerkannt. Sie haben ja Kinder. Das reicht.
Bei Zusatzkräften sieht es noch skurriler aus. Da können Tagesmütter einsteigen und Menschen, die irgendeine Ausbildung oder Berufserfahrung haben, nicht nur eine einschlägige. Selbst die Bäckerei-Fachverkäuferin oder die Hebamme ist gefragt. Das heißt: Jede und jeder kann in der Kita arbeiten.
Genau das stand schon 2017 im Zwischenbericht der JFMK und der Länderarbeitsgruppe zum „Gute-Kita-Gesetz“. Der Begriff Fachkraft wurde dort folgendermaßen definiert: pädagogisch Tätige.
Wer soll das sein?
Jeder! Pädagogisch tätig ist fast jeder Mensch. Ich als Mutter bin pädagogisch tätig. Wenn jemand im Bus einem Jungen sagt, dass er die Füße vom Sitz nehmen soll, ist der auch pädagogisch tätig. So ein dehnbarer Begriff steht in den offiziellen Papieren, wenn es um die Qualität von Kindertageseinrichtungen geht.
Das ist ja ungeheuerlich!
Zwar wurden in dem Zwischenbericht einige Standards gut beschrieben, aber wenn man sich den Fachkraft-Kind-Schlüssel ansieht und die Definition von Fachkraft als „pädagogisch Tätige“ mitdenkt, dann führt das alles, was zuvor geschrieben wurde, ad absurdum, weil jeder in der Kita tätig sein kann.
Das spiegelt auch der Begriff „Kümmerer“ wider. Wenn Frau Giffey sagt: „Wir kümmern uns um die Kümmerer“, meint sie zwar die professionell Tätigen, aber ein Kümmerer kann jeder Mensch sein, aus innerem Antrieb oder weil er nett ist. Schon allein der Slogan von den Kümmerern zeigt, dass es nicht um Professionelle geht, sondern um Leute, die die Arbeit aus inneren Intentionen machen.
Da sind der „Kreativität“ ja keine Grenzen gesetzt…
Richtig. Das nächste sind die multiprofessionellen Teams. Träger sagen: Wir setzen multiprofessionelle Teams ein. Das hört sich toll an, bedeutet aber: Fachfremde werden auf Fachkraftstellen gesetzt. Neulich hatte ich das in einer kleinen Kita erlebt: vier Fachkräfte, zwei Gruppen. Zwei Fachkräfte waren Erzieherinnen, die anderen beiden waren Yogalehrerin und Förster. Das mag ja ganz schön sein, wenn alle da sind und man sich gut versteht. Aber lass mal eine Fachkraft ausfallen! Wenn dann ein Kinderschutz-Fall oder etwas anderes Gravierendes passiert, kann nur noch eine einzige Frau die Fäden fachlich zusammenhalten – bei immerhin 50 Kindern in der Einrichtung.
Dann ist die Kita nur noch eine Aufbewahranstalt.
Genau. Man überlässt es den wenigen Pädagoginnen, die noch da sind, alles zu ordnen, und bürdet ihnen die ganze Verantwortung auf.
Was sagen die Erzieherinnen dazu?
Natürlich merken die Kolleginnen das, diskutieren es im Netz und fragen sich: Warum habe ich eigentlich eine Ausbildung von vier, fünf Jahren gemacht, wenn eine Yoga-Lehrerin das nach 160 Stunden auch kann? Sie sind sauer, fühlen sich ausgenutzt, abgewertet und sagen sich: Da kann ich auch in einen anderen Arbeitsbereich gehen, in dem man meine Fachlichkeit anerkennt.
Wahrscheinlich bleiben viele Fachkräfte trotzdem, weil ihnen die Kinder und Eltern Leid tun.
Außerdem sind viele Erzieherinnen regional verankert, gerade auf dem Land. Sie arbeiten gern dort, wo sie wohnen, richten sich entsprechend ein, können ihre Berufstätigkeit mit dem Privatleben vereinbaren und sind dadurch gebunden. Viele haben selbst Kinder oder Eltern, die sie pflegen müssen. Also finden sie sich mit der Lage ab und lösen die Probleme individuell. Das verhindert letztlich auch Solidarisierung und politisches Engagement.
Was kann man tun? Resignierend mit den Schultern zucken und sagen: Ist eben so?
Es gibt Regionen, in denen sich die Kolleginnen zusammenschließen. Zum Beispiel in Bremerhaven. Dort laden sie Politikerinnen und Politiker ein, stellen Forderungskataloge auf und sind vor dem Rathaus präsent. Da wurde den politisch Verantwortlichen erst bewusst, wofür diese Frauen täglich zuständig sind. Sie machen alles! Wischen den Gruppenraum abends noch mal durch und räumen den Geschirrspüler ein, denn so eine Kita ist wie ein Haushalt organisiert, ohne Entlastung. Jetzt wird das auch im Rathaus diskutiert.
In Niedersachsen gab es die Aktion „Aufstehen für die Kita“. Da haben die Kolleginnen erfasst, ob sie die Aktivitäten, die sie planen, tatsächlich durchführen können. Das meiste fällt aus, stellten sie fest, weil sie immer Personallücken stopfen müssen. Damit sind sie an die Öffentlichkeit gegangen.
Teams könnten auch sagen: So leid es uns tut, liebe Eltern, wir können nicht mehr alles ausgleichen, sondern machen Dienst nach Vorschrift. Wenn die Kita um 17.00 Uhr schließt, gehen wir auch nach Hause und bleiben nicht bis um 18.00 Uhr zum Aufräumen.
Hat das schon mal jemand versucht?
Ja, Lehrer in Niedersachsen haben mal etwas Ähnliches gemacht. Man hatte ihnen mehr Stunden aufgebrummt, weil Lehrermangel herrschte. Da sagten sie: Das ist zusätzliche Arbeit, die wir neben dem normalen Unterricht organisieren müssen und keine Überstunden angerechnet bekommen. Deshalb machen wir alle jetzt zwei Jahre lang keine Klassenreisen mehr. Die Kinder waren enttäuscht, die Eltern waren nicht amüsiert und beschwerten sich im Kultusministerium. Das hat also schon etwas bewirkt.
Andererseits: So etwas öffentlich zu machen ist Arbeit. Man muss sich dafür engagieren, obwohl man schon am Limit ist.
Es ist noch nicht lange her, dass der Kita-Bereich die Öffentlichkeit entdeckt hat, zum Beispiel die regionale Presse…
Vor allem, wenn es etwas Schönes zu berichten gibt.
Ja, Erfolge tragen zum Renommee einer Kita bei. Probleme in die Öffentlichkeit zu tragen – das ist eine ganz andere Sache. Da sind Verhaltensregeln zu beachten und…
… bestimmte Wege einzuhalten, sonst gibt es Ärger, verständlicherweise.
Herrscht eine Situation starken Mangels, haben Leiterinnen die Verpflichtung, dem Träger das anzuzeigen. Können Teams nicht mehr so arbeiten, wie sie müssten, die Aufsichtspflicht zum Beispiel nicht mehr erfüllen, müssen Leiterinnen das melden, und der Arbeitgeber muss den Mangel abstellen: eine Gruppe schließen lassen, Kinder nach Hause schicken lassen, die Öffnungszeiten verkürzen – das gibt es alles. Jedenfalls trägt der Arbeitgeber die Verantwortung und hat eine Fürsorgepflicht. In diese Pflicht müssen die Kolleginnen ihn nehmen, statt Probleme zu subjektivieren und zu sagen: Das regeln wir schon selbst.
Warum machen Kita-Leiterinnen das so selten? Vielleicht befürchten sie, dass gesagt wird: Die Frau hat ihr Team nicht im Griff.
Ja, aber das ist Quatsch und riskant! Das müssten sich Kita-Leiterinnen eigentlich selbst sagen. Letztendlich, wenn einem Kind etwas passiert und die Kolleginnen oder die Kita-Leiterin haben ihre Überlastung vorher beim Arbeitgeber nicht angezeigt, haften die Pädagoginnen. Daher ist Solidarität wichtig – die Solidarität der Leiterinnen eines Trägers und der Kolleginnen miteinander. Sie müssen feststellen: Wir können diese Probleme nicht lösen. Wie denn auch? Wo Schluss ist, ist Schluss!
Es gibt doch in jedem Land gesetzliche Vorschriften, was eingehalten werden muss…
Es gibt Länder, in denen Vorgaben deutlich formuliert sind. In Schleswig-Holstein nicht. Da macht das jede Kommune für sich. Man ist jetzt erst dabei, Standards für die Fachkraft-Kind-Relation zu entwickeln: eine Gruppe von 25 Kindern und 1,5 Erzieherinnen. Was 1,5 Erzieherinnen sein sollen, das weiß ich auch nicht.
In Niedersachsen wiederum gibt es Arbeitgeber, die sagen: Sobald der Schlüssel unterschritten wird, schließen wir die Gruppe, reduzieren die Öffnungszeiten oder schicken anderes Personal hin.
Wie geht es in den Ländern eigentlich mit dem „Gute-Kita-Gesetz“ weiter? Angesichts der Personalsituation.
Wir haben den Eindruck, dass die Personalsituation die Länder nicht wirklich interessiert, wenn wir gucken, was sie machen. Fast alle Länder stellen die Elternbeiträge frei. Nur manchmal geht es um Leitungsressourcen oder die Freistellung der Leitung. Einige Länder verweben das mit Kita-Reformprozessen, zum Beispiel das Saarland und Rheinland-Pfalz. Wir wissen nicht genau, ob sich das aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ ergibt oder schon vorher geplant war und sie jetzt nur die Mittel umschichten. Beteiligungsprozesse finden fast nirgendwo statt, obwohl im Gesetz steht, dass die Sozialpartner beteiligt werden sollen.
Und was wird in den Kitas ankommen?
Wahrscheinlich nicht viel. Durch die Entlastung der Eltern – ich bin gar nicht dagegen – wird dem System viel Geld entzogen. Die Nachfrage nach Kita-Plätzen wird eher steigen, und letztendlich stehen dafür überhaupt nicht genügend Mittel zur Verfügung.
Mich wundert übrigens, dass man nicht versucht, die Arbeitgeber in der Wirtschaft in die Pflicht zu nehmen. Wieso beteiligen die sich nicht? Mein Mann ist Unternehmer. Er zahlt für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Kita-Gebühren. Sie müssen den Bescheid vorlegen, dann wird das Geld überwiesen. Es geht um Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sagt mein Mann und findet, dass es seine Aufgabe ist, einen Beitrag dazu zu leisten. Kommt die Gebührenfreiheit, muss mein Mann nicht mehr zahlen. Wie unsinnig ist das denn?
Einerseits entzieht man dem System Geld, andererseits erhöht man die „Attraktivität“ von Kita-Plätzen, obwohl es zu wenig Plätze und Fachpersonal gibt. Die Lösung: Hinz und Kunz betreuen Kinder, ohne dass sie es können. Und alle sollen jetzt die Klappe halten, weil der Kita-Bereich so viel Kohle bekommt.
Es sind 5,5 Milliarden, und die Länder geben noch was dazu.
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist auch subjektiviert, alles wird auf die Frauen, auf die Familien geschoben. Doch um Vereinbarkeit geht es nicht wirklich, sondern um Arbeitskräfte für die Wirtschaft. Angesichts dieses wahnsinnigen Ausbaus, der zu Konditionen stattfindet, die immer schlechter werden, fordert ver.di: Das ganze Geld, das aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ kommt, muss in den Ausbau des Ausbildungsbereichs investiert werden. Es muss in die Fachschul- und Berufsfachschul-Ausbildung fließen, es muss endlich eine bezahlte Vergütung geben, es müssen Formen entwickelt werden, wie Arbeitskräfte, die in anderen Branchen freigesetzt werden, diesen Beruf erlernen und nicht einfach nur angelernt werden, sondern Abschlüsse machen können – bezahlt über die Bundesagentur für Arbeit.
Wie sieht es denn mit der zweiten Initiative von Frau Giffey, der Fachkräfteoffensive, aus?
Frau Giffey sagt, dass sie 5.000 Ausbildungen durchfinanziert, und hat das an Kriterien gebunden, die wir zuvor diskutiert hatten. Aber auch das ist letztlich nur exemplarisch und deklaratorisch, denn der Effekt von 5.000 Ausbildungen ist angesichts der 85.000, die wir im Jahr brauchen, geringfügig. Viel wichtiger wäre, die Strukturen insgesamt zu entwickeln, das mit den Ländern auszuhandeln und in der Kultusministerkonferenz Druck aufzubauen.
Druck besteht ja eigentlich schon. Warum tut sich so wenig?
Weil es um den ganzen Ausbildungsbereich geht, der föderal organisiert ist und an den sich niemand herantraut, da er so zersplittert ist. Außerdem sind Erzieherinnen so etwas wie immerwährende Schülerinnen, denn die Berufspraxis ist an der Ausbildung komplett unbeteiligt. Alles wird von den Kultusministerien der Länder vorgegeben. Zwar werden Praktikantinnen in die Kitas geschickt, und manchmal dürfen Kita-Mitarbeiterinnen beratend tätig sein, doch die Hoheit hat die Schule. Sie nimmt die Prüfungen ab und sagt: bestanden oder nicht bestanden. So bleibt das Verhältnis von Erzieherinnen zur Schule immer gleich: Hier sind die Lehrerinnen, da die Schülerinnen, die keinen Einfluss auf die Ausbildung haben, weder mitbestimmen noch sich einmischen können. Deshalb gibt es auch keine Reflexion dieses Ausbildungssystems aus der Praxis heraus – weder von der Arbeitgeber- noch von der Arbeitnehmerinnenseite.
Und Berufsneulinge belasten die Teams, weil sie keine Praxiserfahrung haben, Fehler machen…
Genau. Das wäre ganz anders, wenn es Mitsprache oder Mitwirkung der Praxis gäbe. Dann könnte man auch die Ausbildung verändern und sagen: Wir setzen uns für bestimmte Inhalte ein, damit sie gelernt werden können. All das findet aber nicht statt.
Für den ganzen Bereich gibt es übrigens auch keine Berufsbildungsforschung. Das ist in den dualen Berufen anders. Da guckt man sich im Bundesinstitut für Berufsbildung an: Wie verändert sich die Gesellschaft? Wie verändern sich technische Herausforderungen, gerade auf dem Gebiet der Digitalisierung? Wie muss die Ausbildung darauf reagieren? Neue Ausbildungsformen werden begleitet erprobt, ausgewertet, und die Ergebnisse werden mit Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreterinnen diskutiert. Das gibt es hier nicht.
Kann das auch daran liegen, dass am Ende der Prozesse keine Produkte stehen, die verkauft werden müssen? Wo es um Bildung und Sozialarbeit geht, stehen am Ende Menschen.
Ja, das kann sein. Aber es hat seinen Ursprung in den politischen Strukturen. Wirtschaft ist aufgrund ihrer Bedeutung bundesweit geregelt. Bildung ist föderal geregelt und bleibt in der Hoheit der Länder.
In der Wirtschaft haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihre Rechte durchgesetzt, vor allem in den Männerberufen. Die Männer haben sich nicht nehmen lassen, mitzusprechen. Vollzeit-Schulberufe sind vorwiegend Frauenberufe, und die strukturelle Benachteiligung dieser Berufe hält sich seit 150 Jahren. Deshalb spreche ich von immerwährenden Schülerinnen. Schon seit Ewigkeiten bringt man Frauen in die Situation abhängiger Schülerinnen, in der sie bleiben. In den meisten Gesprächen zwischen Lehrerinnen und Erzieherinnen zeigt sich dieses Gefälle. Man merkt schon am Habitus, wer sich wem in welcher Form unterwirft. Schrecklich!
Trotz solcher Initiativen wie „Ponte“ zum Übergang von der Kita in die Grundschule hat sich daran nichts verändert?
Nein, weil die Strukturen gleich geblieben sind. Auf der individuellen Ebene kann man durch Projekte etwas erreichen, aber tatsächlich würde sich nur etwas verändern, wenn man an die Struktur herangeht.
Das heißt:Wir haben einen mehrfach abgehängten Bereich, den Frauen-Bereich, in dem es um die Sorge für Kinder, Kranke und Alte geht. Frauengedöns! Sollen sie sehen, wie sie damit klarkommen. Außerdem: Erziehung kann doch jede! Gedöns kann jede! So ist es immer noch.
Interview: Erika Berthold und Lena Grüber
Foto: Addictive Stock / photocase.de
Dr. Elke Alsago ist Diakonin, Diplom-Sozialpädagogin, ehemalige Kita-Leiterin, Fachberaterin und Hochschullehrerin. Heute arbeitet sie als Referentin des ver.di-Bundesvorstands.
