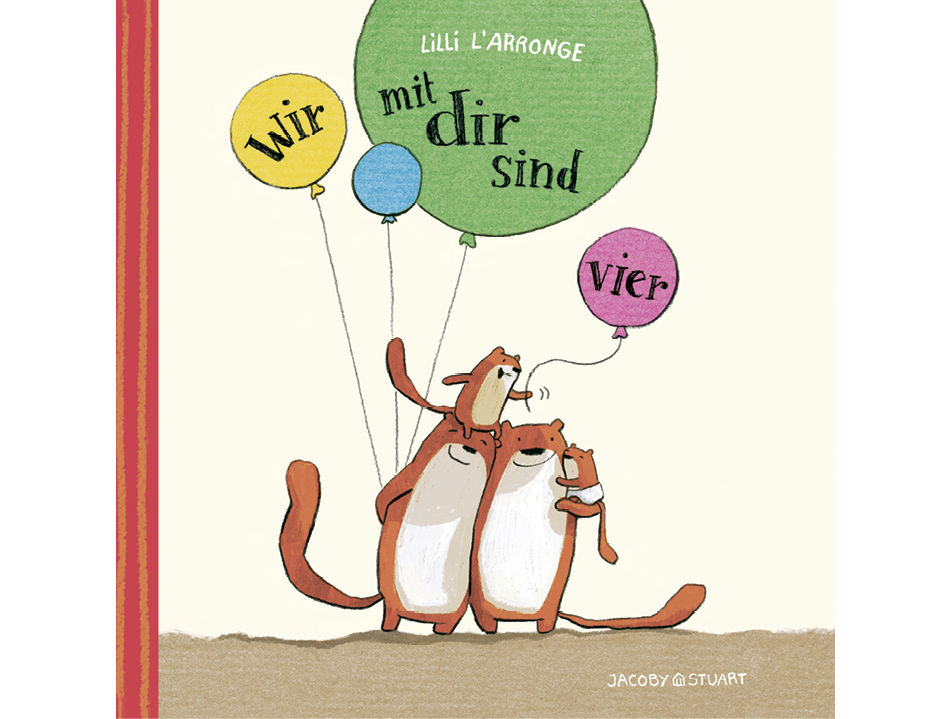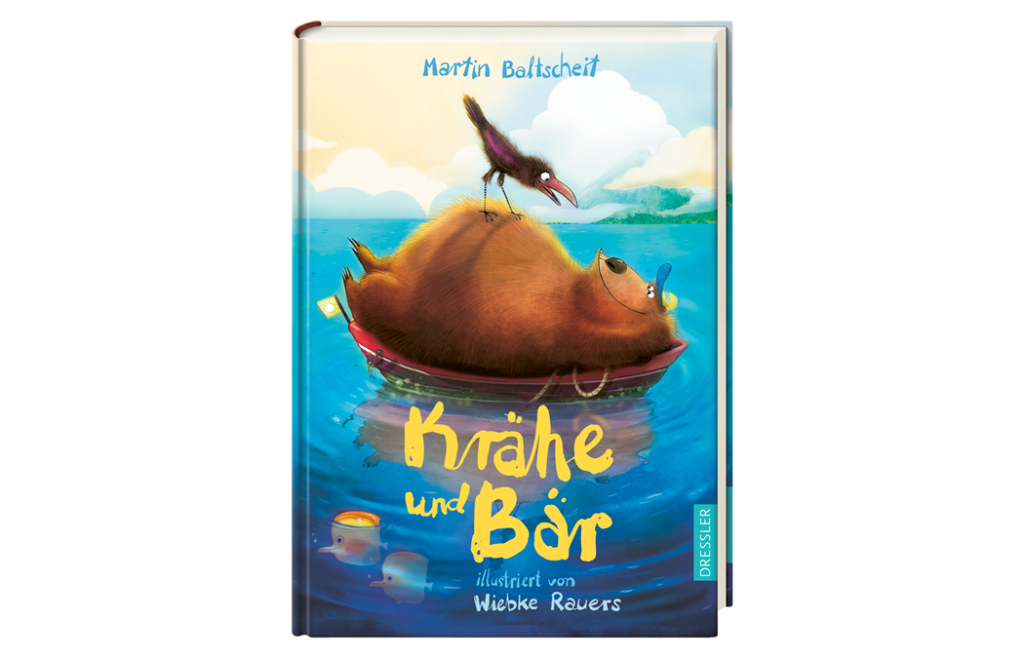Mass Effect: Andromeda

In diesem Sci-Fi-Abenteuer reisen wir mit unserem wahlweise männlichen oder weiblichen Protagonisten in die Tiefen des Universums und besiedeln Planeten. Möglich macht das die Erfindung des Cryoschlafs – ein 600-jähriger Ruhezustand. Am Ziel wartet jedoch eine furchtbare Entdeckung: Die Planeten der Andromedagalaxie, die aus der Ferne vielversprechend aussahen, wurden durch einen künstlich erzeugten Sturm unbewohnbar. Unsere Aufgabe: Herausfinden, wer hinter dieser Zerstörung steckt und wie wir den Prozess rückgängig machen können. Unterstützung erhalten wir dabei nicht nur von der Crew unseres Raumschiffs, sondern auch von Alienvölkern, die ebenfalls auf der Suche nach einer neuen Heimat sind.
„Mass Effect: Andromeda“ ist ein fantastischer Spielplatz für Weltraumentdecker.
wamiki-Tipp: „Mass Effect: Andromeda“ für PC, Xbox One und PlayStation 4 hat die USK-Kennzeichnung „ab 16 Jahren“.
Nioh

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts entdeckt der irische Seefahrer William, dessen Rolle wir übernehmen, eine spirituelle Energiequelle namens Amrita, die ihm übernatürliche Kräfte verleiht. Der Alchemist Edward Kelley will Amrita hingegen nutzen, um eine Armee von Monstern zu beschwören. William erfährt das und verfolgt Kelley bis nach Japan, wo der starken Spiritualität und blutiger Bürgerkriege wegen besonders viel Amrita existiert. In der Fremde muss William zunächst Verbündete finden, die ihn bei der Suche nach Kelley unterstützen. Um ihr Vertrauen zu gewinnen, bekämpft William in actionreichen Schwertkämpfen Dämonen, steigt durch das Sammeln von Amrita im Level auf und erhält neue Kräfte von heimischen Schutzgeistern.
„Nioh“, eine packende Reise durch die japanische Sagenwelt, ist wegen des hohen Schwierigkeitsgrades kaum für Anfänger geeignet.
wamiki-Tipp: „Nioh“ für die PlayStation 4 hat die USK-Kennzeichnung „ab 16 Jahren“.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Bei dieser Spielereihe wird jeder neuer Serienteil auch außerhalb der Videospielszene wie ein Großereignis gefeiert. Wie immer spielen wir Link, den legendären Recken aus dem märchenhaften Land Hyrule. In der liebevoll von Hand gestalteten Spielwelt lassen sich zahlreiche Wälder, Sümpfe, Hochebenen, Dörfer und Gewölbe voller Rätsel erkunden. Uns bleibt überlassen, wohin wir Link schicken und wann wir das eigentliche Spielziel erreichen: die Vernichtung des riesigen Monsters Ganon. Wir können das Spiel also in unserem eigenen Tempo erleben, aber auch direkt nach dem Auftakt zu Ganon marschieren, um ihm die Stirn zu bieten. Wer lieber 100 Stunden lang über Bergketten wandert, Schätze sucht und wilde Pferde zähmt, hat auch seine Freude am Spiel.
wamiki-Tipp: „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ für Wii U und Nintendo Switch hat die USK-Kennzeichnung „ab 12 Jahren“.
 Eine junge Syrerin hatte während ihres Studiums in Damaskus ein Praktikum in einer Kita absolviert. In Damaskus, wohlgemerkt. Vor zwei Jahren war sie geflüchtet, begleitet nun eine Fortbildnerin hin und wieder bei deren Aktivitäten im brandenburgischen Arbeitskreis „Mehrsprachigkeit“ und berichtet den Teilnehmerinnen, dass es in Syrien ein Schulsystem und Vorschul-Kitas gab. Dafür waren ihr die hiesigen Erzieherinnen dankbar, denn sie können sich jetzt erklären, was sie erleben: Etliche syrische Eltern aus den Flüchtlingsunterkünften bringen ihre Kinder mit gepackten Ranzen in die Kitas, weil sie davon ausgehen, dass die Kinder in der Kita schreiben und lesen lernen. Bekommen die Eltern mit, dass das nicht so ist, beschweren sie sich.
Eine junge Syrerin hatte während ihres Studiums in Damaskus ein Praktikum in einer Kita absolviert. In Damaskus, wohlgemerkt. Vor zwei Jahren war sie geflüchtet, begleitet nun eine Fortbildnerin hin und wieder bei deren Aktivitäten im brandenburgischen Arbeitskreis „Mehrsprachigkeit“ und berichtet den Teilnehmerinnen, dass es in Syrien ein Schulsystem und Vorschul-Kitas gab. Dafür waren ihr die hiesigen Erzieherinnen dankbar, denn sie können sich jetzt erklären, was sie erleben: Etliche syrische Eltern aus den Flüchtlingsunterkünften bringen ihre Kinder mit gepackten Ranzen in die Kitas, weil sie davon ausgehen, dass die Kinder in der Kita schreiben und lesen lernen. Bekommen die Eltern mit, dass das nicht so ist, beschweren sie sich.