Warum sind wir, wie wir sind? Und warum stoßen wir damit nicht nur auf Gegenliebe? Erinnerungen an missliche Situationen, Erkenntnisse über Verhaltensweisen, Erfahrungen mit Lösungsmöglichkeiten und Umsetzungstipps – Aline Kramer-Pleßke, Supervisorin und Coach, möchte dazu beitragen, dass wir unsere Potenziale entdecken, unsere Ressourcen stärken, emotionale Entlastung finden und souveräner handeln können.

 Erinnerungen
Erinnerungen
Ein Stoß, und ich fiel nach hinten. „Aua!“ Das tat weh. Ich fasste mir an den Mund und hielt entgeistert meinen Zahn in der Hand. Was war passiert?
Damals war ich in der ersten Klasse und zankte mit meiner besten Freundin. Worum es ging, weiß ich nicht mehr. Ohne nachzudenken, schimpfte ich los, und sicher habe ich sie beleidigt. Jedenfalls holte meine Freundin aus und schlug mir meinen letzten Milchzahn aus. Ich war erschrocken, und sie sah verstört aus. Das tat mir irgendwie leid. Ich fühlte mich schuldig und gleichzeitig unterlegen. Andererseits: Endlich war ich diesen blöden Wackelzahn los und bedankte mich bei ihr. Wahrscheinlich war das meine Art, mich zu entschuldigen, und die Ausrede vor mir selbst, den Schwanz eingezogen zu haben. Kurz darauf gingen wir wieder spielen.
Nun, wir reagierten damals so, wie wir konnten. Andere Möglichkeiten standen uns nicht zur Verfügung. Ich schrie sie an, sie schlug zu. Beide waren wir hilflos und wussten nicht, wie wir unseren Konflikt anders hätten lösen können.
Die Basis eines Konfliktes: Mindestens zwei Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse oder Absichten und glauben, nur eins davon kann verwirklicht werden. Unter Umständen bleibt das eigene Bedürfnis also unerfüllt.
Auslöser für den Streit in der Kindheit war vermutlich mein Bedürfnis, Recht zu haben. Dass ich mich für den Schlag bedankt hatte, könnte an meinem damals ausgeprägten Bedürfnis, gemocht zu werden, gelegen haben. Das war früher mein stärkstes Bedürfnis. Ich hätte fast alles dafür getan, meine Freundin zu behalten und nicht allein dazustehen.
Erfahrungen
Eines Tages rief mich ein Kita-Koordinator an und berichtete aufgeregt von einem Konflikt in einem Kita-Team, der den Alltag störe und für allgemeine Unzufriedenheit sorge. Viele Team-Mitglieder seien krank, sagte er. Nun wolle man zeitnah einen Teamtag nutzen, um dem Konflikt auf den Grund zu gehen.
Als das Team zu mir in die Praxis kam, war die Atmosphäre spürbar angespannt. Dicke Luft.
Konflikte kann eine Person mit sich selbst oder mit anderen Personen haben. Angeblich geht es um sachliche Entscheidungen, tatsächlich aber um tieferliegende Bedürfnisse und Erwartungen. Die wahren Streitgründe werden in der Regel sorgsam verborgen – wenn sie den Streitenden überhaupt bewusst sind.
Zunächst glichen wir Erwartungen ab, und ich ließ ein Stimmungsbild erstellen. Die meisten Mitarbeiter*innen fühlten sich als Teil des Teams und fanden die Struktur gut. Dennoch war ihnen durchaus bewusst, dass etwas „im Argen“ lag, dass es irgendein „Ding“ gab. Aber dieses „Ding“ war nicht greifbar. Gemeinsam erforschten wir, wie es sich äußerte.
Zunächst wurde deutlich, wie unterschiedlich die Mitarbeiter*innen verschiedene Situationen wahrgenommen hatten – nämlich aus der jeweils eigenen Perspektive. Wir erarbeiteten, welche Abhängigkeiten es gab, wer auf wen in welcher Weise angewiesen war und was das in der Zusammenarbeit bewirkte. Offensichtlich war es sehr schwierig, Probleme oder Fehler zu benennen, weil alle es nett und friedlich haben wollten.
Ich fragte die Mitarbeiter*innen, was das Thema hinter dem Thema sein könnte. Niemand wagte, es auszusprechen. Deshalb erklärte ich dem Team das bekannte Eisbergmodell: Nur ein kleiner Teil einer Botschaft – cirka 20 Prozent – ist wirklich sichtbar. Alles andere – cirka 80 Prozent – kann nur vermutet werden. Diese verdeckten Informationen werden häufig auf der Beziehungsebene ausgetragen. Es sind Stimmungen, Gefühle, Werte, Interpretationen, Missverständnisse, strukturelle Bedingungen, Sichtweisen oder auch ganz persönliche Probleme, die verborgen bleiben und häufig unbewusst ausagiert werden. Natürlich wirkt sich das auf die Inhaltsebene aus.

Der Blick auf das Eisbergmodell wirkte zunächst entlastend. Also forschten wir weiter, und ich fragte die Mitarbeiter*innen, bis wann das Klima gut war und ab wann es sich veränderte.
Nun kamen wir dem wesentlichen Punkt näher: Eine heißgeliebte ältere Kollegin, die allen Halt gegeben hatte, war vor einem halben Jahr in Rente gegangen. Fast zeitgleich gab es einen Leitungswechsel. Rollen wurden neu besetzt oder veränderten sich, vieles war unklar. Das Team befand sich in einem Veränderungsprozess, war tief verunsichert, und die Mitarbeiter*innen versuchten in dieser Zeit, besonders vorsichtig miteinander umzugehen. Es sollte so harmonisch bleiben, wie es zuvor gewesen war. Das Ergebnis: Missverständnisse, Vertrauensverlust, Enttäuschungen, Unsicherheiten, Grüppchenbildung, Klagen und Anklagen. Kritik zu äußern und anzunehmen, das war jetzt noch schwerer als sonst. Die meisten Mitarbeiter*innen sagten von sich, dass sie Angst hatten, in Auseinandersetzungen zu gehen. Es war kompliziert, eigene oder auch fachliche Grenzen zu erkennen und zu ziehen. Außerdem wussten die Mitarbeiter*innen schlichtweg nicht, wie man Konflikte erfolgreich löst.
Konfliktfähig zu sein bedeutet, konstruktiv in Auseinandersetzungen zu gehen. Dazu gehört, eine Basis zu schaffen, die von Toleranz und Offenheit geprägt ist, so dass sich eine faire Streitkultur entwickelt, die Fehler zulässt und die gemeinsame Suche nach angemessenen Lösungen ermöglicht. Das Wichtigste sind jedoch tragfähige Beziehungen, die – Achtung! – nichts mit Küsschen-Kultur zu tun haben, sondern die Grundlage für einen professionellen Austausch schaffen.

Experimente
Sehr hilfreich in Konflikten ist immer ein Blick von außen oder oben. Versuchen Sie, aus der Vogelperspektive auf den Konflikt zu schauen und herauszufinden: Was ist los? Wer ist beteiligt? Um wen oder was geht es wirklich? Wie verhalten sich die Beteiligten? Wie äußert sich das? Was genau ist der Kern des Problems? Dabei hilft, sich bewusst zu machen, dass möglicherweise ein Teufelskreis existiert. Dieser Begriff geht auf Paul Watzlawick zurück. Weiterentwickelt wurde das Modell, mit dem negative Spannungen in Beziehungen erfasst, Hintergründe begriffen und Fallen erkannt werden können, von Christoph Thomann und Friedemann Schulz von Thun. Mit Hilfe des Modells lässt sich einerseits darstellen, was die äußerlich sichtbaren und wirksamen Verhaltensweisen oder Äußerungen der Konfliktparteien sind. Andererseits sind auch die inneren Reaktionen Bestandteile des Teufelskreises, zum Beispiel Gefühle. Sobald ein Konflikt sichtbar gemacht werden kann, greift die Eigenverantwortung, und ein konstruktives Vorgehen wird möglich.
Wie können Sie Konflikte konstruktiv ansprechen? Es gibt eine wirkungsvolle Vorgehensweise. Sie heißt „Sag es!“ und besteht aus folgenden Schritten:
Sichtweise schildern: „Mir ist aufgefallen, dass…“
Auswirkungen beschreiben: „Für mich heißt das…“
Gefühle benennen: „Ich fühle mich…“
Erfragen: „Wie siehst du das?“
Schlussfolgerungen möglichst gemeinsam ziehen:
„Was machen wir jetzt damit?“
Hilfreich ist es, diese Methode im Team zu besprechen und gemeinsam zu üben. Das entlastet im Eifer des Gefechts und ermöglicht auch mal ein Augenzwinkern, wenn Sie sagen: „Ich übe gerade.“
 Kontakt: Beratungspraxis
Kontakt: Beratungspraxis
Mühlenstraße 62-65, 13187 Berlin
E-Mail: info@alinekramer.de
Internet: www.alinekramer.de und
www.perspektiven-coaching-berlin.de

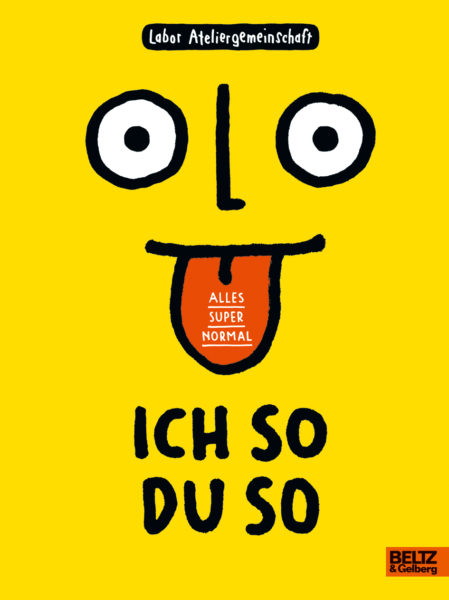
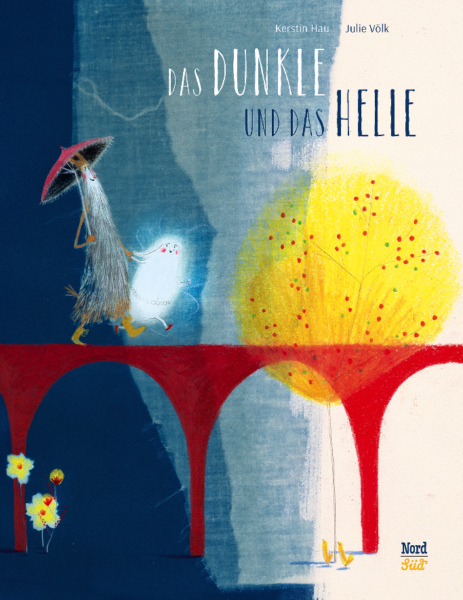


 Erinnerungen
Erinnerungen

 Kontakt: Beratungspraxis
Kontakt: Beratungspraxis




