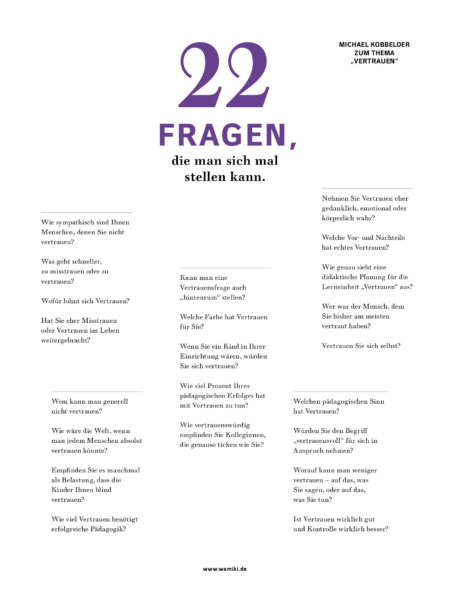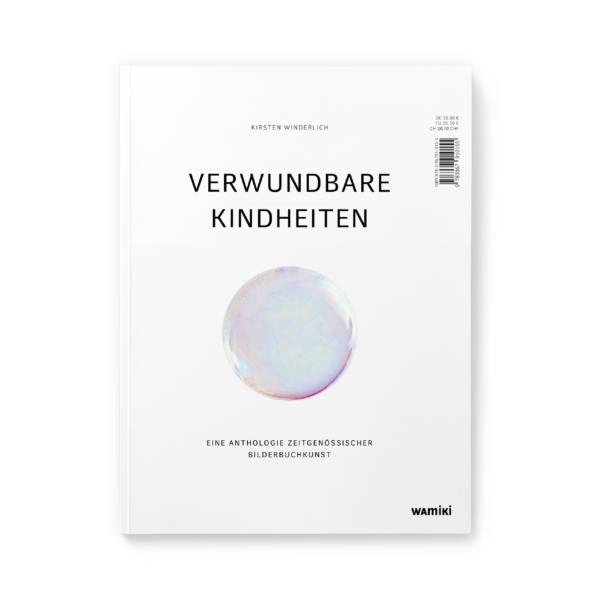Das EDIT-Team empfiehlt die EZEL-Methode: Erkennen, Zurückhalten, Einholen und Spiegeln von Informationen, Lösung aushandeln. Weiter lesen…
Wie kannst du professionell mit Widerständen von Kindern gegenüber Erwachsenen umgehen? Das EDIT-Team empfiehlt fünf Schritte.
Wie kleine Kinder Widerstand leisten und warum es so wichtig ist, ihn wahrzunehmen und darauf einzugehen – ein Gespräch mit Prof. Dr. Frauke Hildebrandt. Weiter lesen…
Wie kann man gut streiten?Das Forum für Streitkultur erprobt, erforscht und trainiert es. Ihre zehn Regeln für eine gute Debatte lauten: Weiter lesen…

wamiki-Hitliste
Was singen die wamikis beim Herstellen dieser Ausgabe? Hört selbst:
Pasta und Parmesan gegen rechts
Mozzarella, Ravioli und Erdbeeren mit Schlagsahne: Bei den Graffitis des italienischen Sprayers Pier Paolo Spinazzè geht es auf den ersten Blick nur um eines – leckeres Essen.
Doch Gemüse, Obst und Pasta verbergen Unappetitliches: Faschistoide Symbole rassistische Parolen, geschichtsvergessenes Geschwätz. Seit Jahren streift Spinazzè durch die Straßen seiner Heimatstadt Verona und übersprüht rechtsextreme Kritzeleien auf Mauern, Garagentoren oder Hydranten. Passend zu seinen Motiven hat er den Künstlernamen „Cibo“ gewählt – das italienische Wort für Essen: Die Kommunen sind verpflichtet, Nazi-Symbole zu beseitigen – „und weil sie nicht hinterherkommen, erledige ich das für sie“, sagt Cibo.
Wie wir richtig streiten
Du bist schuld! Nein, du! Ob Paare, Eltern, Kinder oder Freunde – täglich haben Menschen Probleme miteinander und zoffen sich.
Aber warum streitet man sich überhaupt und wie können Konflikte konstruktiv gelöst werden? Das Audio von Susanne Billig und Petra Geist könnt ihr kostenlos downloaden:
Wie wir Frieden verhandeln
Luxshi Vimalarajeh vermittelt in internationalen Konflikten. Im fluter-Podcast erklärt sie, wie sie mit Terroristen spricht, welche Witze in Friedensverhandlungen funktionieren und warum man ihrer Meinung nach mit Putin verhandeln sollte.
STREIT – eine Annäherung
„Ich will nicht streiten.“ Diesen Satz haben wir alle schon einmal gehört oder gesagt. Doch Streit ist Teil der menschlichen Kommunikation. Er begegnet uns täglich: in den Medien, in politischen oder gesellschaftlichen Debatten, in der Familie oder in der Beziehung. Streit ist wichtig: er gibt uns die Chance, uns zu verstehen, auszutauschen und anzunähern. Die Ausstellung STREIT. Eine Annäherung im Museum für Kommunikation Berlin betrachtet bis zum 27. August 2023 die Entwicklungen, Herausforderungen und die Relevanz von „Streit“ aus historischer, kommunikativer, politischer und persönlicher Perspektive. Damit nähert sie sich dem Wesen des Streits und fördert eine Kompetenz, die für gelingendes Zusammenleben und eine demokratische Gesellschaft unabdingbar ist.
Du hast angefangen – Nein du!
Ein Bilderbuchklassiker mit einer einprägsamen Parabel über Streit und Verständigung.
Zwei Monster, der rote und der blaue Kerl, leben auf beiden Seiten eines hohen Berges. Sie können sich nicht einigen, ob am Abend der Tag geht oder die Nacht kommt, und ebenso am Morgen der Tag kommt oder die Nacht geht. Jeder der beiden ist fest davon überzeugt, dass nur seine Sicht die Richtige sein kann. Einzig und allein nur seine! Und so kommt es zwischen den beiden zu heftigem Streit. Sehr handfest tragen die Kerle ihren Konflikt aus und kommen auf unverhoffte Weise zu einer Lösung. In einfachen Bildern und klaren Farben wird die Geschichte zweier wild streitender Monster erzählt. Das Ende ist überraschend. Ab 4.

David McKee
Du hast angefangen – Nein du!
32 Seiten
Fischer Sauerländer
13,90 Euro
Gutes Ei und böser Kern
Was ist besser: Alles für andere tun oder gar nicht auf andere achten? Wie man immer es handhabt: Beides macht auf Dauer nicht glücklich. Das zeigen die beiden Bilderbuch-Geschichten „Das gute Ei“ und „Der böse Kern“ von Jory John und Pete Oswald. Während die eine daran erinnert, wie wichtig Selbstfürsorge ist, zeigt die andere, wie man sich mit kleinen Gesten zum Positiven verändern kann.
„Das gute Ei“ ist ein seeeeeeeehr gutes Ei. Eine Geschichte, die uns daran erinnert, dass man es nicht immer allen recht machen muss, wie wichtig Selbstfürsorge ist und dass Spaß und Unfug machen zum Leben dazugehören. „Der böse Kern“ ist ein sehr bööööööööser Kern. Eine lustige und zugleich berührende Geschichte, die zeigen, dass positive Veränderungen für jeden von uns möglich sind. Ab 3.


Jory John, Pete Oswald
Das gute Ei / Der böse Kern
je 36 Seiten, Adrian Verlag Berlin, je 12,95 Euro
Foto: Fallon Michael / unsplash
Einmal im Jahr macht das international renommierte Plakatfestival „Mut zur Wut“ die Straße zur Bühne des visuellen Widerstandes. Den Artikel gibt es hier als PDF: Bildstrecke_#2_2023 Über 2.500 Kreative aus über 54 Ländern formulieren ihre Wut über Missstände in mutigen plakativen Botschaften. Pro Jahr. Teilweise trotz Zensur in den Heimatländern. Eine international besetzte Jury…
Schluss mit den Befehlen!
Horch! sagt der Storch.
Renne! sagt die Henne.
Schlaf! sagt das Schaf.
Geh! sagt das Reh.
„Ja, aber –“
Gib Ruh! muht die Kuh.
Nimm Platz! sagt der Spatz.
Geh weg! sagt der Schneck.
Komm her! sagt der Bär.
Los raus! sagt die Maus.
„Ja, aber darf ich denn nicht –“
Nix da! kräht der Ara.
Hör mal! sagt der Wal.
Tu nicht so! sagt der Floh.
Sei still! sagt der Mandrill.
Psst leise! sagt die Meise.
„Schluss! Aus! Ich will endlich mal
tun und lassen,
was ich will!“ sage ich.
Sieh mal an! sagt der Hahn.
Okee! sagt das Reh.
Na klar! sagt der Star.
Verzeih! sagt der Hai.
Kein Heft ohne Gedicht.
Diesmal aus: Großer Ozean. Gedichte für alle. Herausgegeben von Hans-Joachim Gelberg. Beltz & Gelberg, Weinheim 2000, S. 78
Ausgesucht hat es Marie Sander.
Foto: Markus Winkler/unsplash
Hier gibt es den Artikel als PDF: Wortklauber_#2_2023
Immer noch Krieg, dauernd hasserfüllte Auseinandersetzungen statt Einigkeit im Klimaschutz, verbaute Landschaften und hässliche Städte, schlechte Stimmung im Team: Es gibt viele Gründe, sich mehr Harmonie auf der Welt zu wünschen.
Harmonie bedeutet Einklang, Ebenmaß, Gleichklang der Gefühle und stammt von dem griechischen Wort „zusammenpassen“ ab. Welche Wege schlug die Menschheit vor, um zu mehr Harmonie zu gelangen? Und was wird heute empfohlen?
Die Sache mit dem Apfel klären
Religionen wie Judentum, Christentum und Islam teilen den Glauben an die Erlösung, die uns zu einem verlorenen Urzustand der Harmonie zurückführt. Demnach verspielten wir die Harmonie, als das erste Pärchen vom Baum der Erkenntnis naschte. Doch durch bestes menschliches Streben könnten wir die Harmonie vielleicht wieder zurückgewinnen.
Bis heute prägt dieser Erlösungsgedanke viele Vorstellungen von „besseren Gesellschaften“. In großen Utopien wie dem Sozialismus und in individuellen Projekten wie dem Zusammenleben in Landkommunen steckt die Idee von einer besseren, harmonischen, konfliktfreien Welt.
Den universellen Zahlencode finden
„Schläft ein Lied in allen Dingen…“ Was Eichendorff einst dichtete, erinnert an das Harmonie-Verständnis der alten Griechen. Sie gingen davon aus, dass sich eine vollendete Harmonie hinter allen Erscheinungen der Welt verbirgt, die man nur finden muss. Hinter Symmetrie oder besonders angenehmen Klängen und Maßverhältnissen vermuteten sie mathematische Zusammenhänge, die quasi universelle Harmonie herstellen. Auch die Gestirne bewegen sich nach der Theorie klassischer Denker auf mathematisch perfekten Bahnen, wobei sie die leider unhörbare Sphärenmusik erzeugen.
Einklang mit der Natur finden
Lebt die Natur mit sich im Einklang? Die Vorstellung, man müsse nur zu den Gesetzmäßigkeiten der Natur zurückfinden, prägt uns schon seit Urzeiten. Auch die Vertreibung aus dem Paradies kann man so verstehen: Apfel gegessen, schlauer als die Tiere sein, aber den Garten Eden dadurch verloren haben.
Auch der Garten im Wort Kindergarten passt zu dem Bild von wahrer Harmonie in der Natur. Für Friedrich Fröbel war das Ziel der Erziehung, den Einklang der Gegensätze von Natur (dem Inneren) und Geist (dem Äußeren) herzustellen, also die Harmonie des Menschen mit der Welt, der Natur, den anderen Menschen und Gott.
Das optimale Gesellschaftssystem entwickeln
„Der Edle strebt nach Harmonie, nicht nach Gleichheit.“ Für den chinesischen Philosophen Kong Fuzi, bei uns Konfuzius genannt, war Harmonie ein herausgehobener Wert. Das greift die chinesische KP gerne auf, um ihre Vorstellung eines optimalen Gesellschaftssystems zu propagieren. Harmonie entsteht, wenn solch ein System alle Bedürfnisse der Menschen optimal in Einklang bringt – auf der Grundlage einer stabilen politischen Ordnung. Mit anderen Worten: Harmonie und echte Demokratie schließen sich irgendwie aus, denn letztere lebt ja vom Streit.
Alle Entwicklungsbedürfnisse erkennen
Von Harmonie durch ein perfektes Gesellschaftssystem träumten viele Menschen, auch Maria Montessori: „Der wahre Friede bedeutet Sieg der Gerechtigkeit und der Liebe unter den Menschen, bedeutet eine bessere Welt, in der Harmonie herrscht“, postulierte sie. Ihr Weg zur Harmonie: die Entwicklungsbedürfnisse von Kindern erfüllen.
Im Inneren suchen
Findet man echte Harmonie nur in sich selbst? Je weniger die Menschen an bessere Gesellschaftssysteme glauben, desto mehr scheinen sie die Sache mit der Harmonie bei sich selbst zu verorten. Unter dem Kofferwort „Achtsamkeit“ werden unterschiedlichste Wege empfohlen, um Harmonie zu finden – beim Yoga, mit Atemtechniken oder beim Ausmalen von Mandalas. Inzwischen sehen auch die Kultusminister darin Potenzial: In Bildungsempfehlungen werden Achtsamkeitskurse gegen Lehrermangel angepriesen. Ist ja auch kostengünstig.
Ins Innere aufnehmen
Preiswerter ist nur die orale Einnahme von Harmonie: „Innere Harmonie“, weiß die Firma „Yogi Tea“, „ist ein hohes Gut und dieser Tee dein Wegweiser dorthin. Der Weg beginnt mit einem Moment des Innehaltens, in dem Zitronenmelisse, Lavendelblüten und Zimt dich begleiten und dir eine gute Portion Gelassenheit mitgeben. Hast du zur Harmonie gefunden, kannst du sie teilen.“
Noch besser bringt nur ein Anbieter die Sache auf den Punkt: Wenn bei Kleinkindern das Innere nach außen dringt, bleibt es wohlverwahrt – in der Windel der Pampers-Serie „Harmonie“.
Auf Postern propagieren
Wie sieht es in unserem Bereich aus? Regelposter verraten, was Grundschule und Kindergarten unter Harmonie verstehen. Dort liest man: „Wir streiten achtsam“, „Freundliche Worte finden“, „Wir halten immer zusammen“ und „Ich freue mich, wenn es meinen Freunden gut ergeht“. Oder auch: „Unsere Trinkbecher sind nur zum Trinken da.“ Endlose Diskussionen im Chat oder TV über „Systemsprenger“, „Regelbrecher“ und die „Kleinen Paschas“ von Merz zeigen: Wir gehen immer noch davon aus, dass es Harmonie geben könnte, wenn sich endlich alle an die Regeln halten würden. Auch die, denen das immer so schwerfällt.
Abbildung: harmoniumnotes.blogspot.com
Welchen Begriff aus der Pädagogik haben wir im übertragenen Sinn collagiert? Die Buchstaben in den hellen Kästchen ergeben den Lösungsbegriff.
Unter Ausschluss des Rechtsweges verlosen wir 10 x das Buch: „Die Kita als weltoffenes Dorf“.
PS: In Heft 5/2022 suchten wir den Begriff: Die Sprachförderung.
Die Redaktion gratuliert allen Gewinnerinnen und Gewinnern.
Bild: Marie Parakenings
Schickt eure Lösung per Post an:
wamiki
Was mit Kindern GmbH
Kreuzstr. 4 ∫ 13187 Berlin
oder per E-Mail an:
info@wamiki.de
Stichwort: Bilderrätsel.
Einsendeschluss ist der 31. März 2023.
Hier gibt es den Artikel als PDF: allerletzes+Termine_#1_2023
Pädagogik lebt von Ritualen, heißt es. Erzieher, Lehrer und *innen machen alles Mögliche, weil es nun mal derzeit üblich oder sogar vorgeschrieben ist. Egal, ob es Sinn hat oder nicht. Sinnvoll ist es aber auf jeden Fall, ab und zu auszumisten. Deswegen stellt diese Rubrik pädagogische Gewohnheiten aufs Tapet und fragt ganz ergebnisoffen: Ist das pädagogische Kunst, oder kann das weg?
Das Stühlchen
Erwachsenen sitzen so gerne. „Setzt euch erst mal“, sagen sie Gästen zur Begrüßung. Nach einem anstrengenden Tag des Sitzens im Büro lassen sie sich daheim aufs Sofa fallen. Aus Sicht von Kindern scheinen Erwachsene an ihren Stühlen angewachsen zu sein, wenn sie miteinander reden, essen, trinken oder Karten spielen.
Klar, dass Erwachsene von sich ausgehen und Kindern in der Kita Stühlchen hinstellen, auf denen sie den Tag verbringen sollen. Manchmal sind es regelrechte Sessel aus Holz, schwer und mit Armlehnen. Tatsächlich verbringen kleine Kinder, setzt man sie erst mal rein, viel Zeit im Stühlchen.
Weil sie gerne sitzen? Wohl eher, weil sie sich aus dem Sitzmöbel schlecht befreien können. Beherrschen Kinder die Technik des Stuhlwegschiebens, kann man beobachten, dass sie nur wenig gern im Sitzen machen. Malen, Werkeln, Spielen und Reden macht offenbar mehr Sinn im Stehen. Selbst beim Essen bleiben manche Kinder ungern lange sitzen.
Warum gibt es dennoch in vielen Kitas, vor allem in Krippen, so viele Stühle, dass mancher Raum fast zum Stuhllabyrinth wird? Damit sich Kinder an die Kultur des Zusammensitzens gewöhnen? Seid nicht albern, Sitzen lernt man sowieso. Weil sich Kinder manchmal auch ausruhen mögen? Dafür passt ein Sofa am Rand besser als ein Tisch mit zehn Stühlchen außen herum. Warum dann? Weil es praktisch ist, Kinder auf Stühlchen zu parken, um das unkontrollierte Gewusel im Raum zu minimieren? Weil kleine Kinder auf Stühlchen sich nicht selbst bedienen können, beim Essen nicht zu früh aufstehen und freiwillig Gesellschaftsspiele spielen?
Egal, warum: Weg mit den Stühlen! Nutzt den freien Bodenplatz zum Malen, Toben, Liegen, Stehen und Sitzen. Das geht besser ohne Stuhl.
Foto: Julia Beautty/ photocase
Die Phase der Kindheit ist besonders verwundbar.
Die Ausmaße von Verwundbarkeit können dabei vielschichtig sein: Ausgelöst durch Verlust, Diskriminierung und Gewalt, äußert sich Verwundbarkeit durch Gefühle wie Unsicherheit, Schmerz, Angst und Ohnmacht. Herabsetzung, Demütigung und Ausgrenzung können derart kränken und einsam machen, dass Hoffnungslosigkeit entsteht.
Menschen sind verwundbar, weil sie abhängig sind von anderen. Es gibt Menschen, die sind stärker verwundbarer als andere. Und gleichzeitig sorgen Regierungsweisen dafür, dass die mit der Verwundbarkeit bestimmter Gruppen einhergehende Unsicherheit der Lebensverhältnisse sich verstetigt und als „normal“ erscheint.
Wollen wir unsere Wahrnehmung für die Verwundbarkeit von Kindern und Jugendlichen sensibilisieren, müssen wir sie sichtbar machen. Und zwar ohne den „pädagogischen Zeigefinger“ zu bemühen und damit Gefahr zu laufen, die von Verwundbarkeit Betroffenen zu stigmatisieren. Zeitgenössische künstlerische Bilderbücher liefern uns zahlreiche Beispiele.
Kirsten Winderlich gibt Einblicke in 21 außergewöhnliche Bilderbücher, die Prozesse der mannigfaltigen Auswirkungen und „Töne“ von Verwundbarkeit und Ermächtigung in Bild und Text zeigen. Anregungen zur erweiterten ästhetischen Rezeption ermöglichen uns, in magischen Bildern und Worten spazieren zu gehen und Impulse für die Bildungspraxis mit Kindern aufzufangen.
Neu bei wamiki
Kirsten Winderlich, Verwundbare Kindheiten, Eine Anthologie zeitgenössischer Bilderbuchkunst
144 Seiten, mit vielen farbigen Bildern, ISBN 978-3-96791-015-5, 19,90 Euro
Zu bestellen unter: wamiki.de/shop