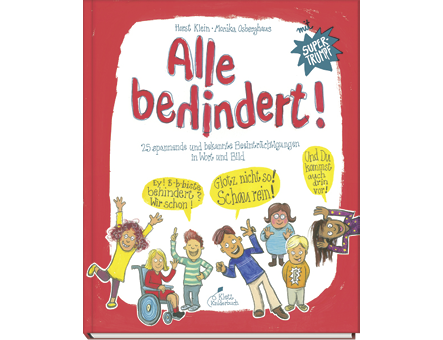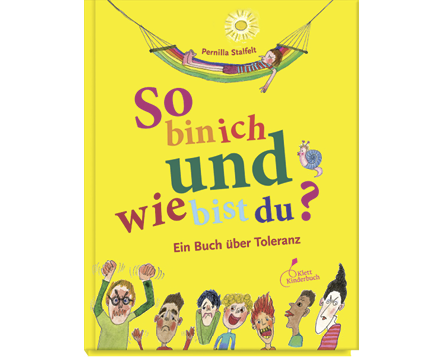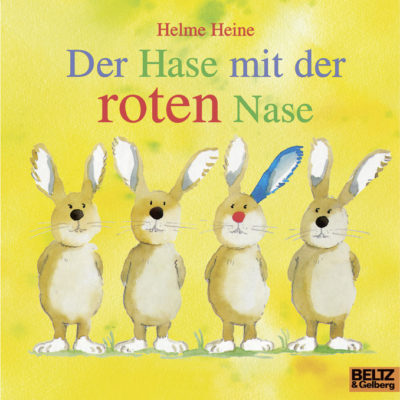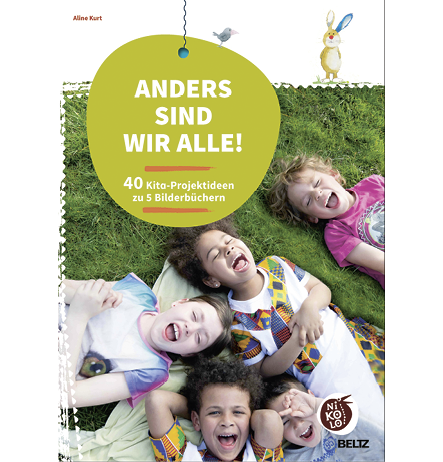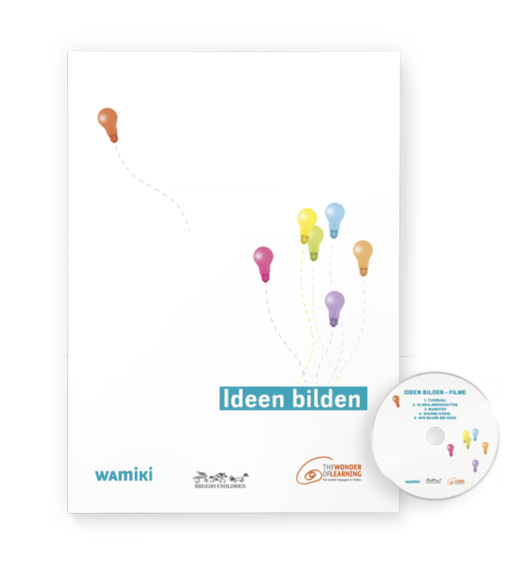Hast du dich auch schon mal gefragt, wie ein „normales“ Kind zu einem „auffälligen“ Kind wird? Oft passiert das schleichend … und mit der Sprache fängt es an. Denn Sprache schafft Bedeutung. Wie wäre es wohl, wenn wir dem bisher Eingeschliffenen und täglich Gehörten eine neue Bedeutung geben würden? Weiter lesen
Aha, da haben wir wieder ein verhaltensauffälliges Kind. Wodurch fällt es auf? Weiter lesen
Die Mode-Diagnosen für die 30er, 40er, 50er — bis in die 80er Jahre Weiter lesen
Hier gibt es den Artikel als PDF: Wie seht ihr das_#4_2022 Das Modellprojekt „Kinderperspektiven im Kita-Beirat“ Kinder müssen über Dinge, die ihre Lebenswelt betreffen, (mit)entscheiden können. Das ist nicht nur ihr Recht, sondern auch der pädagogischer Anspruch frühpädagogischer Bildungseinrichtungen, insbesondere im Situationsansatz. Mit der Einführung des Kita-Beirats verankert das Bundesland Rheinland-Pfalz rechtlich die Erfassung der…
Wer entscheidet, wann, was, wie viel und mit wem Kinder essen und trinken? Frauke Hildebrandt berichtet von persönlichen Erfahrungen und einigen Ergebnissen der BiKA-Studie BiKA – was? Was untersucht die BiKA-Studie? Im BMFSFJ-Projekt „Beteiligung im Kita-Alltag“ (BiKA) haben wir uns typische Partizipationssituationen angesehen, und zwar in 89 Krippen und Krippenbereichen in Kitas deutschlandweit. Neben Spielen…
Gabriela Zion arbeitet als Psychologin und Psychodrama-Therapeutin in einer Berliner Tagesgruppe für Kinder, die nur bedingt schulfähig und sehr „auffällig“ sind. Im wamiki-Gespräch erzählt sie von diesen Kindern und davon, wie sie mit ihnen umgeht. Weiter lesen…
Hier gibt es den Artikel als PDF: Panorama_#4_2022
Help!
Was singen die wamikis beim Fertigstellen dieser Ausgabe?
Hört selbst. Hier ist die wamki-Hitliste zum Thema „Auffällig“:
Was ist Neurodiversität?
Hast du schon einmal von AD(H)S oder dem Autismus-Spektrum gehört? Oder fühlst du dich manchmal rat- und hilflos, weil dich einzelne Kinder (und Erwachsene) mit ihrem Verhalten irritieren? In diesem kostenlosen (pädagogischen) Onlinekurs erläutert die Dozentin Anne Kuhnert kurzweilig und spannend, was Neurodiversität bedeutet und welche Wirkungen Nichtverstehen und Abwerten für das Leben und Lernen von betroffenen Kindern und Erwachsenen haben können.
Alle behindert?
Dieses Buch macht Schluss mit dem seltsamen Einteilen in „Eingeschränkt“ hier und „Normal“ dort. Es geht um uns alle.
25 bekannte Beeinträchtigungen inklusive deiner eigenen kannst du hier näher kennenlernen. Ab 5 und für alle.
Alle behindert! 25 spannende und bekannte Beeinträchtigungen in Wort und Bild. Von Monika Osberghaus und Horst Klein. 14,00 Euro, Klett Kinderbuch, ISBN 978-3-95470-217-6
So bin ich und wie bist du?
Toleranz, Integration, Inklusion, kulturelle Vielfalt – lauter wichtige Werte, die wir Kindern vermitteln möchten. Nur wie, ohne dass es überkorrekt, langweilig und abstrakt rüberkommt? Pernilla Stalfelt buchstabiert das Thema Toleranz so unterhaltsam und witzig durch, dass man gar nicht merkt, wie sehr man ins Mitdenken gerät. Ab 5.
So bin ich und wie bist du? Ein Buch über Toleranz von Pernilla Stalfelt.
13,00 Euro, Klett Kinderbuch, ISBN 978-3-95470-097-4)
Klassiker für alle ab 2
Es freut sich der Hase mit der roten Nase: „Wie schön ist meine Nase und auch mein blaues Ohr, das kommt so selten vor!“ Die eingängigen Reime im Bilderbuch von Helme Heine, erzählen davon, anders zu sein und dass gerade in der Vielfalt das Glück liegt. Zum Vorlesen für Kinder ab 2.
Der Hase mit der roten Nase. Vierfarbiges Papp-Bilderbuch von Helme Heine. Bilderbuch, 6 Euro, Beltz, ISBN 978-3-407-77006-6
Anders sind wir alle!
Oft kommt es zu Erstaunen, Ausgrenzung oder Streit, wenn Kinder nicht verstehen, warum jemand anders aussieht oder sich anders verhält. Dieses Praxisheft für Erzieher*innen enthält 40 Projektideen zu fünf Bilderbüchern zum Thema: Vielfalt leben und schätzen.
Anders sind wir alle! Projekteheft von Aline Kurt. 16,95 Euro, Beltz, 978-3-407-72739-8
Unsichtbar werden
Kannst du dich unsichtbar machen? Teile von dir vervielfachen? Können wir unsere Kräfte vereinigen? Kinder spielen gern mit Veränderungen, Verwandlungen und Variationen der eigenen Identität. Die Photoshop-Software kann dabei Werkzeug und Bündnispartner für Kinder und Erzieher*innen werden.
Ideen bilden. 23 Poster mit DVD. Herausgegeben von Reggio Children. 29,90 Euro, w amiki, ISBN 9783945810163
Schau durchs Fenster!
Schmulst du gern heimlich in andere Häuser? In Katerina Goreliks Bilderbuch darfst du nach Herzenslust in fremde Fenster schauen. Kocht die liebe ältere Dame, die in einem Topf rührt, wirklich nur das Mittagessen – oder ist sie vielleicht eine Hexe, die einen Zaubertrank braut? Und – oh Schreck! – was macht der hungrige Wolf denn dort im Wohnzimmer? Erst beim Umblättern siehst du, was sich wirklich in den Häusern abspielt – und dass es nicht immer das ist, was du erwartest …
Ein originelles Bilderbuch mit ausgeschnittenen Fenstern, das zum Entdecken überraschender Szenen einlädt und mit den eigenen Erwartungen spielt. Ab 3.
Schau durchs Fenster! Von Katerina Gorelik. 16 Euro, Insel Verlag, ISBN 978-3-458-64335-7

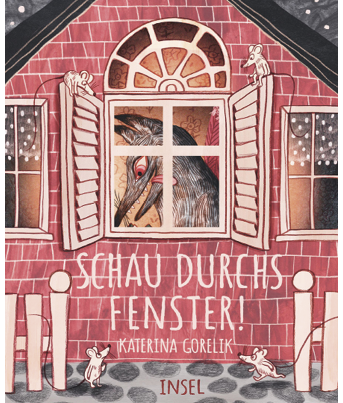
Foto: Krockenmitte/photocase.de
Hier gibt es den Artikel als PDF:
Adrian lebt einsam und verspielt in einer Welt in Schwarz-Weiß. Fast jeden Tag geht er mit einem Knoten im Magen zur Schule. Wenn er dort ist, fühlt er sich allein und anders als die anderen. Am schlimmsten ist es, wenn die Lehrer ihn bitten, laut vorzulesen: Dann vermischen sich die Buchstaben, die anderen Kinder beginnen zu lachen und zu sticheln. Die ganze graue Welt scheint plötzlich einzufrieren und Adrian flieht in seine eigene Welt.
Diese ist warm und voller Farben, denn in seiner Phantasie wachsen Adrian Flügel: Als Akrobat der Lüfte fliegt er durch das Zirkuszelt und begeistert das Publikum.
Doch als er die Hündin Niebla trifft, ändert sich alles. Jemand glaubt an ihn, und plötzlich wird Adrians Leben in Schwarz-Weiß farbig.
In dem facettenreichen Comic von Kristin Lidström und Helena Öberg spielt Farbe eine entscheidende Rolle. Der Übergang von Schwarz-Weiß-Comics zu vollfarbigen Seiten spiegelt Adrians Gefühle wider und betont die Kraft der Vorstellungskraft.
Das Buch verwendet zwei Sprachen – Comics und Illustrationen – um die Welt eines Kindes auszudrücken, dessen oft einsames Leben im Kontrast zu seiner starken Vorstellungskraft steht, die ihm hilft, seine Schwierigkeiten zu überwinden.
Eine fesselnde Graphic Novel über Verletzlichkeit, Wut, Trauer, Sehnsucht und die transformative Kraft der Vorstellungskraft. Die fast wortlose Erzählung öffnet das Buch für alle Leser*innen ab 8.
„Du bist dran, Adrián“ von Helena Öberg und Kristin Lidstrom (Übersetzung: Kristina Lund) ist in schwedischer und spanischer Sprache erschienen (schwedisch: ISBN9789198139679, spanisch: ISBN 9788494573576 ) und kostet 13,00 Euro.
NICHT DAS, WAS MAN SICH VORGESTELLT HAT
sagt Gustavo Rosemffet, einer der wichtigsten Illustratoren im spanischsprachigen Raum und erzählt eine tolle Liebesgeschichte zwischen Vater und Sohn. Weiter lesen
Über den Jägern jagt der größre Hund
Wenn ich mit den Beuteträgern
ziehe durch den dunklen Grund,
droben über allen Jägern
jagt als Wind der größre Hund.
Denn im Rücken spür ich einen,
der in meinem Jagen jagt,
und mein Herzschlag ist dem seinen
wie ein Knecht nur, der sich plagt.
Wie ein Knecht nur, der die Beute
sich zu schwerer Bürde häuft,
der im Winde hört die Meute,
die sein Laufen überläuft.
Zieh ich mit den Beuteträgern
dunkel durch den alten Grund,
droben über allen Jägern
hungrig jagt der größre Hund.
Kein Heft ohne Gedicht.
Diesmal aus: Peter Huchel: Havelnacht. Mit Fotografien von Roger Melis. Insel Verlag, Berlin 2020, S. 8.
Ausgesucht hat es Marie Sander.
Foto: David-W- / photocase.de
„Auffällig“ heißt das Thema dieses Heftes. Das Wort hat es in sich, obwohl es doch – Achtung: Wortspiel – so unauffällig daherkommt. Denn „auffällig“ kann mit ganz unterschiedlichen positiven wie negativen Wertungen versehen sein, die sich gut unter der Unauffälligkeit des Wörtchens verstecken lassen.
Begeben wir uns auf eine Reise durch verschiedene Deklinationen des Wortes und ganz unterschiedliche Verwendungsweisen.
Ich falle auf.
Wer diese drei Wörter selbstbewusst ausspricht, merkt: Mit dem Auffallen hat es eine besondere Bewandtnis. Obwohl das Verb im Aktiv steht, ist Auffallen keine aktive Tätigkeit. Ich kann zwar durch besonderes Benehmen oder Bekleidung versuchen, die Aufmerksamkeit anderer Leute auf mich zu ziehen. Aber ob ich auffalle oder nicht, entscheiden letztendlich die anderen. Das wissen besonders die Menschen, die aufgrund von Behinderung, Hautfarbe, Körpergröße, Gewicht oder anderer Dispositionen auffallen, ohne dass sie das möchten. Sie werden ständig betrachtet, während das „Mauerblümchen“ übersehen wird.
Interessant: „Ich falle mir auf“ funktioniert sprachlich, aber nicht inhaltlich.
Du fällst mir auf.
Viele persönliche Beziehungen beginnen mit einem besonderen „Auffallen“. Person A nimmt unter vielen anderen Menschen Person B als etwas Besonderes wahr. Person B fühlt sich entweder geehrt, weil sie Person A aufgefallen ist, oder ihr ist A selbst „aufgefallen“. Ideale Grundlage für einen Flirt? Dazu sagen WissenschaftlerInnen: Offenbar finden Menschen andere Personen besonders dann positiv „auffallend“, wenn sie erstens gängigen Schönheitsklischees entsprechen und zweitens im positiven Sinne durchschnittlich wirken. „Du bist mir gleich aufgefallen“ könnte also heißen: „Du erinnerst mich an einen Mix aus diversen Schönheitsklischees.“
Er fällt auf.
In vielen Märchen, Mythen und Geschichten gibt es einen „besonderen“ Mann oder Jungen. Joseph aus der Bibel sieht mit besonders buntem Rock besser aus als seine Brüder. Mozart ist schon als Kind ein Wunderknabe, Leonardo wird es als Erwachsener. Viele dieser Helden fallen erst auf und dann auf die Fresse: Mozart verarmt, Siegfried wird ausgetrickst, Van Gogh wird verrückt… Zwar scheint die Zeit der Heldenverehrung heute passé. Doch immer noch führen uns Filme und Bücher den „auffallenden“ männlichen Einzelkämpfer vor, der die Dinge auf seine Art regelt – von Wickie im Trickfilm bis zum eigenbrötlerischen Kommissar im Sonntagskrimi.
Sie fällt auf.
Als auffallende Männer noch das Nonplusultra waren, waren auffallende Frauen verdächtig. In den Kinderbüchern der Fünfzigerjahre waren das beispielsweise die „Wildfänge“: Mädchen, die durch burschikoses Verhalten, lautes Lachen und allzu kräftige Stimmen auffielen, bevor sie dann von einem toleranten Jung-Förster gezähmt wurden. Auch heute noch gelten Frauen als auffallend, wenn sie sich in Männerdomänen behaupten wollen. Dann zeigen sie „ungewöhnliche Härte“, „eisernen Willen“ oder „beißen“ gar männliche Rivalen weg, die sich ihnen eigentlich überlegen fühlten.
Es fällt auf…
…dass es immer bestimmte Personen sind, die…
Egal, ob es um Kevins Verhalten im Matheunterricht oder statistisch ermittelte Durchschnittsverhaltensweisen irgendwelcher Bevölkerungsgruppen geht: Die Formulierung „Es fällt auf…“ bietet sich immer an, wenn man Vorurteile und Vorverurteilungen loswerden möchte, ohne allzu konkret zu werden. Zum Beispiel fällt auf, dass viele Maskenverweigerer in der Bahn männlich sind, eine bestimmte Herkunft haben, bis zum Plattenbauviertel fahren… Das Praktische an diesem „Es fällt auf…“ ist: Achtet man mal darauf, ob etwa „alle Kevins verhaltensauffällig sind“, wird jeder Treffer dieses Bild bestätigen.
Ist dir schon aufgefallen, dass unter den Maskenverweigerern wirklich jede Bevölkerungsschicht vertreten ist? Eben.
Wir fallen auf!
Auffallen kann sehr schön sein, wenn man es gemeinsam tut. Fällt der Kirchenchor aus Bad Sumpfingen durch lautes Gackern in der Berliner S-Bahn auf, steigert das die Stimmung der Beteiligten. Gemeinsames Auffallen hat nämlich nichts mit dem Leid einsamen Auffallens zu tun, sondern verleiht das Gefühl: Jetzt setzen wir die Norm, indem wir gegen die von der Mehrheit gesetzte Norm verstoßen! Viele eher randständige soziale Gruppen genießen es, ihr individuelles Außenseitersein durch gemeinsames Auffallen zu kompensieren.
Ihr fallt auf!
Häufig hören Kinder in Gruppen und erst recht Jugendliche diese streng gemeinte Feststellung – gerne garniert mit dem Adjektiv „unangenehm“. Wer die Formulierung verwendet, macht klar, dass er auf der Seite derjenigen steht, die über richtiges – „unauffälliges“ – und falsches Verhalten entscheiden. Dazu steht im Widerspruch, dass wohl jede pädagogische Einrichtung heute behauptet, „jedes einzelne Kind im Blick zu haben“. Damit das auch wirklich klappt, ist Auffallen aber geradezu nötig. Andererseits suggeriert der Tadel „Ihr wolltet immer auffallen“, dass es nichts Besseres gibt, als von PädagogInnen übersehen zu werden.
Sie fallen auf.
So geht „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“: Man ordnet Menschen einer Gruppe zu, um ihnen danach eine gemeinsame Differenz zum angeblich „Normalen“ zu unterstellen. Ein Trick, der fast in jeder Diktatur funktioniert, weil er Gruppen besser stabilisiert als jedes Teambildungs-Seminar. Norbert Elias1 kennt das Rezept: Man bildet aufgrund irgendwelcher simpler Merkmale (Hautfarbe, Religion, Sprache, Körpermerkmale) eine Außenseiter-Gruppe, der man die als negativ wahrgenommenen Eigenschaften innerhalb der eigenen Gruppe unterstellt („gemein zu Frauen“, „geizig“, „fauler als andere Menschen“). Das entlastet die eigene Gruppe („Ich bin nicht so frauenfeindlich wie die…“) und vereinfacht die Rollenfindung auf beiden Seiten. Innerhalb kleinerer Gruppen übernehmen die anfangs irritierten „Außenseiter“ nun teilweise die vorgegebenen Rolleneigenschaften, um nicht noch mehr „aufzufallen“.
1 Der deutsch-britische Soziologe Norbert Elias (1897-1990) gilt als einer der Begründer der modernen Soziologie.
Foto: Jonathan Schöps/photocase.de