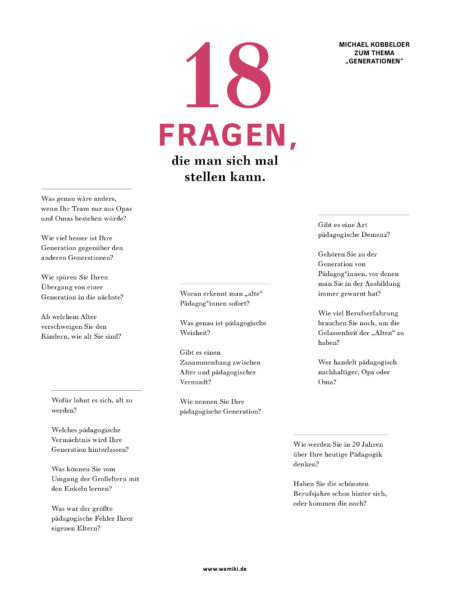Aktuelle Studien Weiter lesen
„Kinder machen bei der Bekämpfung des Infektionsrisikos gut mit. Sie verabschieden ihre Eltern an der Kita-Eingangstür, lassen sich in Gruppen einteilen, halten Abstand und waschen sich oft die Hände. Die Gefahr, dass dabei lebenswichtige Bedürfnisse nach Verbundenheit, Autonomie und Sicherheit zu kurz kommen, wird kaum thematisiert“, stellte man im Netzwerk Offene Arbeit Berlin/Brandenburg (NOA) fest. Christiane Feuersenger berichtet von den Erfahrungen, Positionen und Vorschlägen des Netzwerks.
Als die Tolai vor etwa 250 Jahren auf ihre heutige Heimatinsel in Papua-Neuguinea kamen, suchten sie Schnecken. Genauer: Nassarius-Schnecken, die im seichten Küstenwasser leben. Sie sind das „Tabu“, das Muschelgeld – die Urwährung der Tolai. Der Schweizer Fotograf Claudio Sieber hat die Hüter des Muschelgeldes besucht. Weiter lesen…
Zum ersten Mai
Ich mag einmal nicht klassenkämpfen.
Das soll man im November tun.
Ich will zum Lied die Leier dämpfen
Und waldwärts ziehn auf Flügelschuhn.
Da wohnt der Mai auf einer Wiese.
Und Birken stehen. Und der Wind
Ist lau, als wenn er gar nicht bliese.
Und jeder Käfer ist mein Kind.
Doch will mich wer davongehn heißen,
Weil er der Eigentümer sei,
Dann werd ich den mit Hölzern schmeißen
zum ersten Mai.
Kein Heft ohne Gedicht.
Diesmal aus: Alle Tage ein Gedicht. Aufbau Verlag, Berlin 2013, S. 128
Ausgesucht hat es Marie Sander.
Foto: Jutta Schnecke, photocase
Warum heißt es „arm“ und „reich“? Schon die Wortherkunft sagt, was Sache ist, denn „reich“ ist mit dem Reich verwandt. Beide Wörter stammen vom Mittelhochdeutschen rich ab, das edel, mächtig oder von vornehmer Herkunft bedeutet und wahrscheinlich auf das germanische „Rik“ zurückgeht, das wiederum vom lateinischen „Rex“ herrührt, sprich: „König“. Herrlich, als „Reicher“ der edle König vornehmer Abkunft zu sein! Fast vergisst man darüber, die Herkunft des Wortes „arm“ zu erforschen. Wiktionary sagt: Herkunft umstritten; vielleicht stand ein vergessenes Wort für „verlassen“ Pate. Man merkt: Selbst mit dem Wort mag sich niemand so recht beschäftigen.
Hier gibts den Artikel als PDF: Wortklauber_Gedicht_wamiki_#5_2021
Arm und reich gibt es auch als Nomen. Faszinierend, dass man dafür beiden Wörtern die gleichen Buchstaben anhängt, aber in umgedrehter Reihenfolge. Arm kriegt „-mut“. Klingt mutig, kommt aber von „Gemüt“ und sagt, dass Armut eigentlich eine Art Gefühl ist. Reich erhält ein „-tum“, mit dem man auch Eigentum und Königtum bildet, den Irrtum allerdings ebenfalls. Als Nachsilbe verweist „tum“ auf Besitz, Macht oder Würde. Reichtum ist also ein uralter Euphemismus für Besitzen und Herrschen, während Armut von der Wortherkunft bedeutet, sich verlassen zu fühlen, statt handeln zu können.
Wer reich ist, hat gute Mächte an seiner Seite – Arme wurden verlassen. Für die frühen Kulturen und Religionen war deswegen klar: Reiche sind gut, denn sonst würden die Götter sie ja nicht belohnen, während Arme aufgrund ihrer Verfehlungen mit Mangel bestraft werden. Verarmten ganze Gesellschaften, war es manchmal die beste Lösung, erfolglose gegen erfolgreiche Religionen zu tauschen: „Ich wechsele jetzt zu Zeus, der zahlt besser.“ Eine andere Lösung entwickelte sich im Judentum nach der Verarmung durch die „Babylonische Gefangenschaft“: Gott ist auf der Seite der Armen, die im Jenseits reich werden. Diese Idee steckt auch hinter der biblischen Legende von Lazarus, der arm und krank vor dem Haus des reichen Mannes von dessen Speiseresten lebt. Nach dem Tod beider Männer kommt Lazarus in „Abrahams Schoß“, während der Reiche im höllenähnlichen Hades landet. Warum bloß? „Nach dem Tode wird alles umgedreht“, erklärt Abraham, „du hast ja deinen Reichtum schon gehabt, aber Lazarus nicht.“
Für die ersten Christen ist klar: Wer arm und bescheiden nach dem Vorbild des besitzlosen Jesus lebt, gefällt Gott deutlich besser als die Reichen. In seiner Bergpredigt bringt Jesus das auf die Formel: „Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes.“ Ein guter Grundsatz für eine Religion der Outlaws, aber untauglich, wenn man zu Geld gekommen ist. Im Christentum finden sich immer wieder Beispiele von Menschen, die sich bewusst der Armut verschrieben und einer immer reicher und mächtiger werdenden Religion trotzten – etwa die Bettelorden oder Franz von Assisi. Andere versuchten, die Sache mit der Armut abzumildern. Schließlich würde der Satz von den seligen Armen ja auch bedeuten, dass es Gott gefällt, wenn Armut unter den Menschen herrscht. Verstand Jesus „geistlich Arme“ nicht vielleicht als Metapher? Und ist Reichtum nach dem Reformator Calvin nicht vielleicht ein Belohnung für gottgefälliges Tun und nur dann problematisch, wenn jemand mit ihm protzt und ihn nicht teilt?
Das klingt nach uralten Diskussionen, aber die Auswirkungen sind noch heute spürbar. Die Frage, ob Arme ihr Schicksal verdienen und Reiche ihren Reichtum, wird immer wieder gestellt, nicht nur in „Neiddebatten“ oder wenn den „Armen“ fehlendes Engagement vorgeworfen wird und Erbschaftssteuern als Strafe für die Tüchtigen verteufelt werden.
Auch dem aktuell vorherrschenden Lebensstil armer und reicher Menschen merkt man die alten Diskussionen über Protz und verdientes Vermögen an: Arme beschaffen bisweilen Luxusgüter auf Pump, etwa schwarzglänzende Limousinen oder teure Smartphones, um ihren schlechten Status zu kompensieren. Reiche hingegen demonstrieren Bescheidenheit und ethisches Denken, wenn bäuerliche Olivenholz-Möbel aus der Toskana in ihren Lofts stehen, das Macbook auf strenges Design setzt und alle Lebensmittel von regionalen und gerechten Herstellern stammen.
Hat das was mit uns zu tun? Allerdings. Denn wir PädagogInnen sind besonders empfänglich für die Frage, ob es besser ist, gut zu sein als reich. Wir spielen das Spiel von den guten Armen weiter, wenn wir auf Fragen wie „Ist dir das nicht zu wenig Geld?“, „Kriegst du Überstunden bezahlt?“ oder „Ersetzt dir jemand das Materialgeld?“ antworten: „Mir geht es eh um die Kinder.“ Es wäre sinnvoll, die Bescheidenheit fallen zu lassen – schon weil manche der von uns betreuten Kinder ohne unsere Mitwirkung nicht superreich geworden wären.
Fordern wir also: „Reichtum für alle!“ Zumindest so lange, bis eines fernen Tages Jeff Bezos oder der Immobilienspekulant vom Mietshaus nebenan aus dem Hades mailen: „Damned hot here!“
Foto: knallgrün, photocase
an Dietmar von der Forst

Wann bist du glücklich?
Wenn ich auf der Bühne rumwuseln kann.
Was regt dich auf?
Unpünktlichkeit.
Was fällt dir ein, wenn du an deine Kindheit denkst?
Drei Geschwister, viel Blick ins Grüne.
Was kannst du von Kindern lernen?
Unbeschwertheit und Spontanität.
Was schätzt du an einem Menschen am meisten?
Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit.
Was kannst du am besten?
Gute Atmosphären schaffen.
Was kannst du überhaupt nicht?
Alles, was mit Büro und Zahlen zu tun hat.
Auf welchen Gegenstand kannst du verzichten?
Auf ein Auto.
Wenn du plötzlich eine Stunde geschenkt bekämst – wofür würdest du sie nutzen?
Um auf die Bühne zu kommen.
Was wünschst du dir?
Zufriedenheit.
Dietmar von der Forst ist ausgebildeter Grafikdesigner und Theaterpädagoge. Er arbeitet mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und alten Menschen als theaterpädagogischer Leiter, Regisseur und Geschichtenerfinder. Darüber hinaus beschäftigt er sich mit Museumspädagogik und veranstaltet Workshops mit Kindern und Jugendlichen. Für seine Projekte entwickelt er das Grafikdesign. Kontakt: info@theater-workshop. de
Theater als Gesundheitsprävention Der Theaterpädagoge Dietmar von der Forst begleitet verschiedene Altersgruppen als Regisseur und Ideen-Geber. Im wamiki-Gespräch berichtet er über seine Arbeit mit Jugendlichen und Kindern und erklärt, warum Theater-Spiel Gesundheitsprävention ist. Weiter lesen…
Welchen Begriff aus der Pädagogik haben wir im übertragenen Sinn collagiert? Die Buchstaben in den hellen Kästchen ergeben den Lösungsbegriff. Unter Ausschluss des Rechtsweges verlosen wir 10 x das Buch „Das Wunder des Lernens. Die hundert Sprachen der Kinder“.
PS: In Heft 3/2021 suchten wir den Begriff: Die Schuldistanz. Die Redaktion gratuliert allen Gewinnerinnen und Gewinnern.
Bild: Marie Parakenings
Schickt eure Lösung per Post an:
wamiki
Was mit Kindern GmbH
Kreuzstr. 4 ∫ 13187 Berlin
oder per E-Mail an:
info@wamiki.de
Stichwort: Bilderrätsel.
Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2021.
Pädagogik lebt von Ritualen, heißt es. Erzieher, Lehrer und Innen machen alles Mögliche, weil es nun mal derzeit üblich oder sogar vorgeschrieben ist. Egal, ob es Sinn hat oder nicht. Sinnvoll ist es aber auf jeden Fall, ab und zu auszumisten. Deswegen stellt diese Rubrik pädagogische Gewohnheiten aufs Tapet und fragt ganz ergebnisoffen: Ist das pädagogische Kunst, oder kann das weg?
Lobverbot
„Das hast du toll gemacht, Elisa“. Der Nächste bitte: „Richtig super gemacht, Elias!“ Nein, es ist bestimmt nicht sinnvoll, jedes Kind immer und ewig zu loben, auch wenn es gar nichts Besonderes gemacht hat. Etwa, wenn Elisa das dreißigste Prinzessinnen-Ausmalbild präsentiert, Elias hingegen das Blatt mit drei markanten Strichen gefüllt hat.
Aus dieser Selbstverständlichkeit leiten wohlmeinende Pädagog*innen eine generelle Forderung ab: Man solle Kinder gar nicht loben, denn damit bewerte man sie ja. Denn auch bei positiven Bewertungen stelle man sich ja damit als „Bewertender“ über sie. Stattdessen, erklären die wohlmeinenden Pädagog*innen, sende man bitteschön Ich-sehe-Botschaften, die das Wahrgenommene beschreiben: „Ich sehe, dass du ganz lange an deiner Sonne gemalt hast. Ich mag Sonnen.“;„Ich sehe dich, wie du den Baum hochgeklettert bist.“
Mal überlegen: Fühlt sich das Kind unterdrückt, wenn es uns um unser Feedback bittet und das Bild zeigt? Natürlich nicht, es will ja sogar unser Lob einheimsen. Fühlt es sich auf unangemessene Weise gebauchpinselt oder hält sich für die Superkünstlerin, weil wir es bisweilen auch für Kleinigkeiten loben? Nein, jedes Kind spürt, ob da ein Erwachsener total begeistert ist oder nur ein bisschen nett sein will. Und: Kann das Kind auf dem Baum etwas mit unserer pädagogisch wasserdichten Neutral-Aussage anfangen, wir sähen es? Was soll es antworten – außer „Ich sehe dich auch!“
Übertriebenes Lob für Nichtigkeiten ist unauthentisches Getue, klar. Aber gedrechselte Worthülsen als Antwort auf den alltäglichen Wunsch, wahrgenommen zu werden, sind ebenso unauthentisch. Statt über die passende Worthülse nachzudenken, sollten wir besser danach streben, in solchen Momenten echtes Interesse zu zeigen und damit Nähe zu entwickeln: „Hey, klasse! Wie bist du darauf gekommen, gibt es einen Trick? Ist die Aussicht gut?“
Foto: Knallgrün, photocase