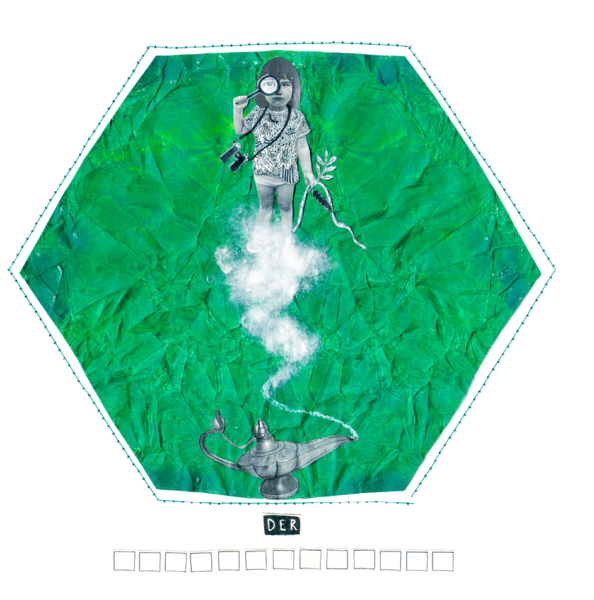Immer wieder wird darüber diskutiert, ob sich die Arbeit in Kitas nicht zu stark auf die Autonomie der Kinder konzentriert, während die Gemeinschaftsfähigkeit vernachlässigt wird. Häufig wird darauf verwiesen, dass es früher so war: Im Osten des Landes ging es um die Gemeinschaft, im Westen eher um Individualität. Frauke Hildebrandt macht sich Gedanken über Solidarität und Autonomie in der Kita. Man könnte auch sagen: über Gemeinsinn und Eigensinn. Sie beteiligt uns an ihren Überlegungen und lädt ein, mitzudenken und auszuprobieren.
Was heißt denn überhaupt Autonomie?
Dass jeder machen kann, was er will?
Mein Autonomie-Begriff folgt den Philosophen Kant und Tugendhat: Der Mensch handelt dann autonom, wenn er es schafft, das zu tun, was er selbst richtig findet und von dem er meint, nachdem er ernsthaft darüber nachgedacht hat: Das ist das, was ich will. Wenn ich es schaffe, das zu tun, handle ich autonom.
Allerdings setzt dieser Autonomie-Begriff voraus, dass ein Mensch in der Lage ist, darüber nachzudenken, was für ihn gut ist, sich ein Ziel zu setzen und daran festzuhalten. Und was ist eigentlich mit Solidarität gemeint?
Solidarität – mit wem und weshalb?
Okay, dachte ich, das steht ja überall: Kinder sollen mündige Menschen werden, die in der Lage sind, sich in die Gesellschaft einzubringen. Dazu müssen sie im eben beschriebenen Sinne autonom sein. Doch wie hängt Autonomie, also diese Form von Eigensinn und Rationalität, mit Solidarität zusammen? Als ich dieser Frage nachging, stellte ich fest, dass es sehr unterschiedliche Definitionen für Solidarität gibt.
Landläufig bedeutet Solidarität, dass Menschen zusammenstehen, solange sie ein Ziel teilen. Zum Beispiel: „Arbeiter aller Länder, vereinigt euch!“ Das heißt: Arbeiter haben ein gleiches Ziel, wollen etwas in der Arbeitswelt verändern und stehen, solange sie dieses Ziel anstreben, füreinander ein. Das hat aber etwas Exklusives. Bauern dürfen nicht mitmachen.
Es geht also nicht darum, mit den Mitmenschen generell solidarisch zu sein und Gemeinsinn zu haben, sondern: Man will etwas gegen andere Menschen durchsetzen – und sei es aus guten Gründen. Aber: Auch die AfD ist solidarisch, wenn sie etwas durchsetzen will. Mein Fazit: Wenn Solidarität eine Haltung meint, die nur besteht, solange es eine Übereinstimmung der Interessen und/oder Ziele gibt, fasst dieser Begriff nicht, was zum Beispiel meine Studierenden in der Diskussion um Solidarität am häufigsten geäußert haben. Nämlich dass Solidarität einem abverlangt, sich neben jemanden zu stellen, obwohl man seine Ziele und Interessen nicht teilt.
Dieser zweite Solidaritäts-Begriff bezieht sich wahrscheinlich nicht auf große Menschengruppen, sondern auf das engere Umfeld. Ein Beispiel: Rosi ist mit ihrem Mann Bernd auf einer Party und möchte nach Hause gehen. Zwar würde ihr Mann gern noch bleiben, hat also ein anderes Interesse oder Ziel als sie, aber Rosi erwartet, dass er sie nach Hause begleitet. Es ist nicht so, dass sie ein Ziel teilen und deshalb zusammenstehen, sondern Rosi verlangt von Bernd, weil er ihr Mann ist, dass er ihr folgt. Bernd sieht das auch so: Er findet es richtig, aus Solidarität mit Rosi die Party zu verlassen und zu ihren Gunsten auf etwas, das ihm Spaß machen würde, zu verzichten. Würde ihre Freundin nach Hause wollen, wäre Rosi höchst erstaunt, wenn Bernd sie begleiten würde – aus Solidarität.
Diese Art von Solidarität hat also auch etwas Exklusives, obwohl sie sich nicht als im Interessenskampf gegen etwas oder jemanden stellt. Trotzdem kann man an dieser Auslegung von Solidarität einiges klarmachen.
Woran mir aber zunächst lag: Ich wollte einen Solidaritätsbegriff bestimmen, den man tatsächlich als grundlegend – weil nicht exklusiv – ansehen kann, und fand ihn tatsächlich: Es ist die Fähigkeit zu kooperieren, füreinander einzutreten und einander zu helfen – ein Grundprinzip menschlichen Zusammenlebens. Man kann auch Mitmenschlichkeit dazu sagen. Du musst keine Gruppen- oder Verwandtschaftsbeziehung, keine Interessen- oder Zielübereinstimmungen mit Menschen haben, zugunsten derer du sogar von eigenen Zielen absiehst, sondern nur eine ganz grundlegende Ebene: dein Gegenüber.
Diesen Solidaritätsbegriff habe ich mit Autonomie zu verknüpfen versucht und überlegt, wie die beschriebene Form von Autonomie und diese grundlegende Art von Solidarität, die hierzulande ein Erziehungsziel ist, sich zueinander verhalten. Kann man sie wirklich gegeneinander stellen? Gemeinschaft versus Individualität? Solidarität versus Autonomie? Gibt es nicht-autonome und doch solidarische Menschen? Und kann es nicht-solidarische autonome Menschen geben?

Rosi und Bernd mit Rationalität in Symmetrie
Meine These: Solidarität ohne Autonomie ist eher Gehorsam, Unterordnung oder Gruppendruck. Siehe Rosi: Wenn ihr Mann nicht mit ihr nach Hause fährt, weil sie seine Frau ist und er das für sie tut, sondern weil er später eins übergebraten kriegt, dann freut Rosi sich nicht darüber, dass er so gehandelt hat. Es war kein autonomer, souveräner Akt Bernds, sondern Angst vor Stress mit Rosi. Wenn Bernd sich nicht frei und mit guten Gründen entscheidet, sondern Angst vor Rosis Zorn ihm seine Entscheidungsfreiheit nimmt, dann handelt er nicht autonom. Aber Rosi wünscht sich ja, dass er aus freier Entscheidung solidarisch handelt. Würde er aus Angst mit ihr gehen, hätte sie nun tatsächlich Grund, sich zu ärgern – über das nicht-autonome und also unsolidarische Verhalten von Bernd.
Dieses Beispiel lässt sich übrigens auf jedes beliebige Gegenüber beziehen und belegt: Autonomie und Solidarität oder Eigen- und Gemeinsinn kann man nicht trennen. Das eine ist die Voraussetzung für das andere. Oder: Wer nicht autonom ist, kann nicht solidarisch handeln.
Aber: Der Mensch kann nur autonom handeln, wenn er in der Lage ist, darüber nachzudenken, was er tut. Also ist alles, was Nachdenken und Rationalität fördert, autonomie- und solidaritätsförderlich. Dazu gehört auch die Fähigkeit, einen Perspektivwechsel zu vollziehen, also zu erkennen, welche Perspektive der andere Mensch auf das gleiche Phänomen hat. Bleiben wir bei Bernd und Rosi: Bernd hat eine andere Perspektive auf die Party als Rosi, kann sich aber vorstellen, wie die Sache aus ihrer Sicht aussieht. Das heißt: Er weiß, dass andere Menschen andere Perspektiven haben und ebenso autonome Wesen sind wie er. Seine Autonomie, das zu tun, was er für sich als richtig erkannt hat, wird dadurch begrenzt, dass neben ihm Menschen sind, die ähnlich autonom sind wie er. In diesem Fall ist es sogar seine Frau, und er mag sich denken: Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füg auch keinem andern zu. Man kann auch Symmetrie dazu sagen.
Bei Kindern findet sich diese Symmetrie schon früh, belegen Experimente: Wenn Gummibärchen ausgeteilt werden und ein Kind kein Bärchen erhält, finden die anderen Kinder das genauso sonderbar wie das Kind, das kein Bärchen bekam. Dieses Grundbedürfnis nach Symmetrie äußert sich auch im Gerechtigkeitsbedürfnis. Aber – so Immanuel Kant: Wir können dem Symmetriebedürfnis dann gerecht werden, wenn wir nicht nur sagen, wir tun das, weil der andere es genauso braucht wie wir, sondern wenn wir überlegen: Was passiert, wenn wir das, was wir tun, zum Gesetz für alle erheben würden? Alle kriegen ein Gummibärchen. Kriegt jemand keins, sorgen wir dafür, dass er eins bekommt oder protestieren wenigstens.
Wie kommen Kinder dazu, solidarisch zu handeln?
Kinder tun nichts ohne Grund. Das heißt: Wir müssen ihnen Rationalität zuschreiben und ermöglichen, dass sie die Autonomiebedürfnisse anderer Kindern wahrnehmen, also merken, dass andere Kinder neben ihnen genauso sind wie sie. Mehr ist eigentlich nicht nötig, denke ich.
Wenn Autonomie die Voraussetzung von Solidarität ist, ergibt sich Zugehörigkeit wie von selbst, denn: Der Perspektivwechsel auf das andere Kind, das gerade kein Gummibärchen bekam, verschafft eine Art Zugehörigkeitsgefühl jenseits der Gruppenzugehörigkeit. Nämlich: Wir sind alle Kinder und müssen deshalb Gummibärchen kriegen. Oder, eine Etage drüber: Wir sind alle Menschen.
Zum Autonomie- und Symmetriebedürfnis von Kindern gibt es zahlreiche Studien: Schon von 18 Monaten an können Kinder die Bedürfnisse anderer Kinder wahrnehmen, verstehen und einander helfen. Sie sind dazu in der Lage, und du kannst sie unterstützen. Aber wie? Wieder, indem du ihnen Rationalität zuschreibst. Weil manche Kinder noch wenig sprechen, musst du als Erzieherin dein eigenes Inneres in Sprache fassen und ein Modell für Rationalität sein, indem du laut abwägst, vermutest, Bedürfnisse, Gefühle, Absichten, Zweifel und eigene Gründe vorbringst – also das, was du denkst, hörbar oder sichtbar machst und nach außen trägst. Um Rationalität bei den Kindern zu fördern, musst du als Pädagogin eigene Abwägungs- und Entscheidungsprozesse transparent machen.
Natürlich gibt es in der Kita auch nicht verhandelbare, zum Beispiel ethische Regeln, deren Geltung du nicht als verhandelbar darstellen darfst. Andere Regeln sind nicht so grundlegend, zum Beispiel der Beginn der Mahlzeiten. Du musst deutlich machen, warum etwas nötig ist, und darfst nicht so tun, als könne man darüber abstimmen, denn: Nichts ist schlimmer als Fake-Partizipation.
Fällst du eigene Entscheidungen, dann präsentiere Alternativen. Sage: „Ich habe mir das und das überlegt. Für das habe ich mich entschieden, weil ich denke, es passt gut. Das andere war aber auch nicht schlecht.“ Das ist wichtig, weil die Kinder merken: Es gibt immer mehrere Optionen. Idealerweise werden sie in Entscheidungsprozesse einbezogen.
Wie erleben Kinder Autonomie?
Im Kita-Alltag bist du das Gegenüber der Kinder, der andere Mensch im Vergleich zu ihnen. Das zeigst du ihnen, indem du die eigene Perspektive benennst, sie ermutigst, ihre Perspektiven darzustellen, und ermöglichst, dass andere Kinder ihre anderen Positionen oder Empfindungen wahrnehmen können: „Guck mal, dem Peter schmeckt der Blumenkohl. Und dir schmeckt Brokkoli besser.“ Solche schlichten Dinge kannst du gar nicht oft genug ansprechen, denn sie zeigen: Menschen sind autonome Einzelne mit unterschiedlichen Positionen, Sichten oder Geschmäckern.
Helfen kannst du den Kindern, indem du ihre Handlungsabsichten benennst. Versucht Peter, eine Kugel auf der Murmelbahn runterkullern zu lassen, und du siehst, dass die Kugel klemmt, weil sie zu groß ist, sagst du zu Peters Mitspieler: „Guck mal, Peter will die Kugel rollen lassen, aber sie klemmt.“ Das angesprochene Kind erkennt, dass Peter etwas tun will, weil du seine Handlungsabsichten wahrnehmbar gemacht hast, und kann sich etwas einfallen lassen, um Peter zu helfen, oder eine eigene Idee einbringen.
Du musst also viel stärker in den Vordergrund stellen, was in den Köpfen von Kindern passiert. Nicht nur, um dem einen Kind zu zeigen, dass du es im Blick hast, sondern um den anderen Kindern zu zeigen, dass alle mit ihren Handlungsabsichten oder Bedürfnissen autonome Menschen sind.

Konflikte als Lernsituationen
In Konflikten wird Autonomie wirklich erlebbar. Streitet man mit einem anderen Menschen, merkt man: Er hat eine komplett andere Position. Wie kann er nur!
Konfliktsituationen sind ideale Solidaritäts-Lernsituationen, denn jeder kann alles lernen: Du kannst begründen lernen, kannst merken, dass ein anderer Mensch eine andere Position hat, und herausfinden, wie man damit umgehen kann.
Gibt es Streit in der Kita, sorgst du dafür, dass die Positionen der Streitenden erst mal nebeneinander stehen, hörbar oder sichtbar werden, und gibst jedem Beteiligten die Chance, zu seiner Position noch etwas auszuführen. Sind die verschiedenen Positionen oder Sichten dargestellt, fragst du: „Habt ihr eine Idee, was wir jetzt machen können?“ Das führt die Kinder aus der beschreibenden Sicht ihrer Positionen heraus, und sie überlegen, was man tun könnte. Haben sie keine Ideen, kannst du etwas vorschlagen.
Die meisten Konflikte sind mikroskopisch kleine Lernsituationen, prägen aber viel stärker als alle möglichen Angebote, weil die Kinder wahrnehmen, wie du darauf reagierst. Bagatellisieren ist ebenso solidaritätszerstörend wie das Nicht-Hinsehen.
Ein Beispiel: Marie sitzt im Buddelkasten und Lucas haut sie mit der Schippe. Das Mädchen schreit aber nicht, sondern zuckt nur kurz zusammen und buddelt weiter. Es gibt also keine Eskalation. Sollst du etwas tun? Manche sagen: Wenn es kein Theater gibt, dann geh drüber hinweg. Doch gerade in dieser Situation zeigen sich die Werte der Gesellschaft wie durch ein Brennglas: Schweigst du, obwohl Marie und Lucas wissen, dass du alles gesehen hast, dann signalisierst du dem Opfer wie dem Täter: Das ist okay. Damit setzt du eine Norm, die dir nicht gefallen kann. Autonomie- oder solidaritätsförderlich ist sie ohnehin nicht. Also: Aufgreifen, nicht bagatellisieren und den Konflikt nicht für die Kinder lösen, sondern ihn thematisieren.
Zuerst solltest du dich dem Opfer zuwenden, nicht dem Täter. Es sei denn, der Täter ist so handgreiflich, dass du ihn beiseite nehmen musst. Wenn die Beteiligten noch klein sind, gibst du ihnen Worte für das Erlebte: „Der Lucas hat dich gehauen, Marie. Und das tat bestimmt so weh, dass du gar nichts sagen kannst.“ Zu Lucas: „Du warst bestimmt wütend und hast Marie gehauen.“ Damit wird deutlich: Du hast es gesehen. Du bist da und stellst dich zur Verfügung, um mit den Kindern nachzudenken, wie sie weiterkommen können.
Lucas sagt vielleicht: „Aber Marie hat meine Schippe…“ Danach verhilfst du Marie zum Wort, wenn sie nicht spricht: „Du hast hier gesessen und wolltest…“ Zu beiden sagst du: „Was können wir denn jetzt machen? Habt ihr eine Idee?“
Entscheidend ist: Erst mal signalisieren, dass du die Aktion miterlebt hast – und zwar für beide Seiten. Damit machst du die Autonomie beider Kinder erlebbar und schaffst eine Voraussetzung dafür, dass sie sich solidarisch verhalten können.
Übergriffige Assistenzen
Oft gibt es Situationen, in denen die Erzieherinnen Autonomie von Kindern nicht erlebbar machen, weil sie eingreifen, wenn sie meinen, dass ein Kind Hilfe braucht. Ein Beispiel: Max schafft es nicht, die Glaskanne auf den Tisch zu stellen. Statt ihm die Kanne mit den Worten „Jetzt hast du wieder gekleckert, du kannst das noch nicht“ aus der Hand zu nehmen, sagst du: „Die Kanne ist aber schwer. Soll ich dir helfen?“ Dadurch machst du die Perspektive von Max deutlich und benennst seinen Versuch, etwas zu tun, für alle anderen Kinder. Du förderst seine Autonomie, indem du ihm Rationalität zuschreibst. Alle anderen Kinder nehmen das wahr. Du stellst nicht die Gemeinschaft in den Vordergrund – „Jetzt müssen wir alle warten, bis Max…“ –, sondern förderst die Autonomie von Max und stärkst dadurch die Autonomie aller Kinder. Eins sagt dann vielleicht: „Wenn Max die Kanne so anfasst…“ Ein anderes steht vielleicht auf und packt mit an.
Was immer im Konzept deiner Kita steht – es sind diese kleinen Momente, in denen sich zeigt: Es gibt einen Impuls, der autonomieförderlich und gleichzeitig solidaritätsförderlich ist. Schau mal, ob du solche Impulse bei dir wahrnimmst, und bedenke: Menschen, die autonom sind, können auch andere Leute anerkennen. Menschen, die Autonomieerfahrungen gemacht haben, können autonom handeln und sind dieser Erfahrungen wegen solidaritätsfähig.
Solidarische Menschen sind also immer autonom.
Aber gibt es eigentlich autonome Menschen, die nicht-solidarisch sind?
Darüber habe ich nur gesagt, dass das über das Symmetriebedürfnis vermittelt erklärt werden müsste.
Ich habe aber eine Idee davon, wie man sich klarmachen könnte, dass es autonome, nicht-solidarische Menschen nicht gibt. Immerhin.
Lesetipp: Frauke Hildebrandt: Navigieren im Raum der Gründe. wamiki # 5/2018, S. 14-19 UND natürlich online hier