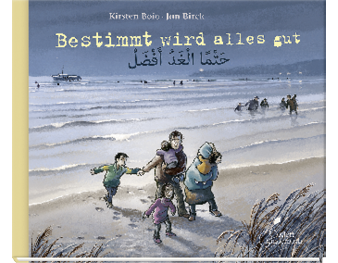Bevor Susanne Hantz Ende 2015 den Job übernahm, sagte ihr Mann Bert: „Susanne, mach´s nicht.“ Worum es ging? Um eine Unterkunft für geflüchtete Menschen: Männer, Frauen, Kinder – insgesamt 260 Leute. Und zwar in einer Turnhalle.
Man erinnere sich: 2015 kamen 890.000 Schutzsuchende nach Deutschland, erklärte der damalige Innenminister Thomas de Maiziére in der „Welt“ vom 30. 9. 2016. Laut Angaben der Senatsverwaltung für Soziales und Gesundheit kamen 79.000 Geflüchtete 2015 in Berlin an, war im „Tagesspiegel“ vom 16. 12. 2016 zu lesen. Knapp 3.000 von ihnen lebten 2016 noch in 38 Turnhallen.

Im Herbst 2015 wurde in der Nachbarschaft des Büros der „Kindererde gGmbH“ eine Unterkunft für Geflüchtete eröffnet. Susanne Hantz, Geschäftsführerin von „Kindererde“, ging vorbei, bot Hilfe an und arbeitete beim Aufbau des bezirklichen Willkommensbündnisses mit. Dass junge Kinder in besonderer Weise ihr Thema waren, überrascht nicht, denn die „Kindererde gGmbH“ ist ein kleiner Kitaträger. Also richtete Susanne mit anderen Ehrenamtlichen einen Kinderraum her und bot regelmäßige Betreuung an.
Die Mitarbeit bei „Willkommen KONKRET – Berliner Bündnis für Kinder geflüchteter Familien“ bestärkte sie in der Überzeugung, dass gesellschaftliches Engagement auf vielen Ebenen nötig ist. Als der Berliner Senat über den Paritätischen Wohlfahrtsverband nach Mitgliedsorganisationen suchte, die Notunterkünfte betreiben würden, beschlossen Susanne und ihr Team: „Das machen wir.“
„Geben wir der Wahrheit die Ehre: Für uns als kleiner Träger war das keine strategische Entscheidung, sondern eher eine emotionale. Willst du dir ein neues Geschäftsfeld erschließen, musst du das anders angehen, würde mir jeder Organisationsberater sagen.“
Anfang November kam der erste Anruf: „Sie hatten sich doch bereit erklärt, und da gibt es jetzt eine Halle…“ Am nächsten Morgen war der Besichtigungstermin. Es stellte sich heraus: eine Doppelturnhalle, ebenerdig, 1970er Jahre, unsaniert. Laut Berliner Standard hieß das in diesem Fall: Die Heizung funktioniert meistens, die Duschen sind gesperrt, eine oder zwei Toiletten sind benutzbar, das Stromnetz ist anfällig.
Die Frage der Damen und Herren aus verschiedenen Ämtern, ob „Kindererde“ ein erfahrener Betreiber sei – „Oh Gott! Nicht schon wieder welche, die keine Ahnung haben“ – ließ sich beantworten: Der Betrieb von Kitas und Erfahrungen in der Flüchtlingsarbeit sorgten dafür, dass das „Kindererde“-Team viele hilfreiche Tipps und Hinweise bekommen hatte. Tatsache war aber, dass die Halle als Notunterkunft so nicht „ans Netz“ gehen konnte. Sanitärcontainer mussten her.
„Ich hatte gesagt: ‚Es ist Winter. Wenn es darauf hinausläuft, dass mehr als 200 Menschen hier leben sollen, und die Toiletten sind alle draußen, dann machen wir das nicht.‘ Da sagte einer: ‚Meine Großmutter hatte das Klo früher auch auf dem Hof.‘ ‚Ja‘, entgegnete ich, ‚aber sie hatte wahrscheinlich einen Nachttopf unterm Bett. Möchten Sie irgendwo einziehen, wo 200 Leute einen Nachttopf unterm Bett haben?‘ Allerdings gab es zu dieser Zeit gar keine Sanitärcontainer: Lieferengpass. Also wurde entschieden, den Sanitärbereich zu sanieren. Gut für die Schule.“
 In den nächsten Wochen hörte Susanne nichts mehr von der Doppelturnhalle, bekam aber zahlreiche Anrufe und Mails mit anderen Angeboten. Doch nach dem Vor-Ort-Besuch hatte das „Kindererde“-Team sich geeinigt: Wir sind bereit, aber wir übernehmen keine einräumige Halle.
In den nächsten Wochen hörte Susanne nichts mehr von der Doppelturnhalle, bekam aber zahlreiche Anrufe und Mails mit anderen Angeboten. Doch nach dem Vor-Ort-Besuch hatte das „Kindererde“-Team sich geeinigt: Wir sind bereit, aber wir übernehmen keine einräumige Halle.
Als Susanne schon dachte, das Ding sei durch, bekam sie am 4. Januar gegen Abend einen Anruf: „Sie hatten sich doch bereit erklärt… Start: morgen.“
Und los ging’s: Alle anrufen, den Plan mit den „Was-wäre-wenn“-Überlegungen aus der Schublade holen, den Caterer, die Security, die Reinigungsfirma und die Wäscherei verständigen. Das war ein bisschen wie beim Beginn einer Geburt.
Am nächsten Tag kamen junge Männer von der Bundeswehr, verlegten Platten auf dem Parkett der Halle, stellten Doppelstockbetten auf und schleppten Kisten. Die Sanitäranlagen waren saniert. Draußen standen zusätzlich einen paar Dixi-Klos.
Immerhin waren die Betten mit Matratzen ausgestattet worden, Handtücher, Kissen und Bettzeug waren vorhanden. Aus den „Kindererde“-Kitas und einem Hort waren überzählige Tische, Bänke und Stühle herbeigeschafft worden. Ein Kopierer stand bereit, Anmeldebögen waren entworfen und Einlassbändchen besorgt worden.
Ein Dorf aus Kokons
So, wie die Geflüchteten im LAGeSo angekommen waren, wurden sie in Busse gesetzt und zur Turnhalle gebracht – am einzigen Januar-Abend, an dem Schnee gefallen war. Ein Bus nach dem anderen fuhr vor.
Im hinteren Teil der Halle lag der große Raum, im vorderen Teil der kleine. Dazwischen Gänge, Sanitär- und Umkleideräume. Die Leute wurden in die kleine Halle gelotst, zu einer Art Check-in-Strecke: Dort konnten sie sich hinsetzen, Tee trinken und sich anmelden. Alle Leute bekamen Einlassbändchen, damit Zugangskontrollen möglich waren. Nach dem Check-in wurden sie in den großen Raum gebracht. Das Team wies ihnen Betten zu: auf der einen Seite die Familien, auf der anderen Seite die allein reisenden Männer. Unter ihnen waren Menschen aus Syrien, dem Irak, aus Afghanistan, Eritrea und Nigeria, aus Moldawien, Tadschikistan und Turkmenistan.
„Wir trennten die Männer nicht von den Familien, obwohl wir wussten, dass das in anderen Notunterkünften üblich war. Wenn es eine Familie geschafft hatte, Krieg und Flucht gemeinsam zu überstehen, kann man die Männer doch nicht extra unterbringen! Außerdem: Wann ist ein Junge ein Mann? Wir weigerten uns, in einem Haus, für das wir die Verantwortung trugen, Männer grundsätzlich als Bedrohung zu definieren. Es musste uns gelingen, eine Atmosphäre von gegenseitigem Respekt zu schaffen. Klar war aber: Die Leute waren deutlich lagererfahrener als wir. Schneller, als wir gucken konnten, hatten sie die Doppelstockbetten zusammengeschoben und mit Laken und Bezügen abgehängt, so dass kleine, geschützte Räume entstanden. Bettwäsche zum Beziehen hatte danach niemand mehr. Erste Lernerfahrung: Wir brauchen Stoff, viel Stoff.“

In der ersten Nacht wurden 245 Menschen aufgenommen. Viele waren krank. Als Susanne deshalb im LAGeSo anrief, riet man ihr, den ärztlichen Notdienst zu verständigen, die Namen der Kranken aufzuschreiben und sie zu isolieren. Doch das war unmöglich. Schließlich wurde ein Sanitäter geschickt, und auch eine Ärztin kam, die Susanne anzischte: „Was denken Sie sich denn? Wir sind für die Bevölkerung zuständig!“
Am nächsten Tag war plötzlich kein Strom da. Dann gab es kein warmes Wasser. Als diese Probleme gelöst waren, konnten die Leute duschen. Überall roch es nach Shampoo, Dampfschwaden krochen durch die Flure, und viele Leute sangen.
Am ersten Tag wanderte Susanne durch die Halle und ließ sich zeigen, wo Säuglinge und Kleinkinder untergebracht waren:
„Ich hatte Sorge, dass wir Mütter haben könnten, die sich in einem Zustand von Erschöpfungsdepression befinden und auf die Bedürfnisse ihrer Kinder nicht mehr eingehen können. In solch einer Situation beginnt Kinderschutz mit einem Stuhl, auf den die Mutter sich setzen kann. Hat sie keinen anderen Platz als das Bett, an dem sie sich aufhalten kann, dann sieht man auch das Kind nicht. Also guckte ich mir alle Babys und vor allem die Mütter an, schaute nach, ob sie stillen oder Babynahrung brauchen. Ich wollte mich vergewissern, dass es ihnen gut geht und dass sie handlungsfähig sind.“
Keine Gewalt!
Müssen sich viele Menschen – entstammen sie verschiedenen Nationalitäten oder seien sie alle Schwaben – eng begrenzten Raum teilen, bleiben Auseinandersetzungen nicht aus. Rigoros warfen Susanne und ihr Team jeden Erwachsenen raus, der zu Gewalt griff. Konflikte beizulegen gelang eher selten, und trotzdem wurden es im Laufe der Zeit weniger.
„Wir wollten uns hinsetzen, über die Probleme sprechen und sie klären. Nur führten die von unserer Kultur geprägten Konfliktlösungsstrategien nicht wirklich zum Erfolg. Im Nachhinein erinnert mich das ein bisschen an unsere Blockflöten-Konzertchen zu Weihnachten. Die Vorstellung war für alle verpflichtend, traf aber überwiegend den Geschmack der Großeltern, und das jüngere Publikum langweilte sich. In der Turnhalle wurden Konflikte häufig irritierend schnell beigelegt und poppten bei der nächsten Gelegenheit wieder auf. Kein Wunder, wenn man sich aufgrund der räumlichen Enge nicht aus dem Weg gehen kann und alles voneinander mitbekommt.“
Geschichten vom Waschen
Anfangs gab es keine Waschmaschinen. Die Leute wuschen ihre Sachen mit der Hand. Überall hing nasse Wäsche, darunter riesige Pfützen. Susanne befürchtete, dass der Hallenboden das nicht lange aushält. Also kaufte sie eine Wäscheschleuder.
„Niemand wusste, was das ist. Eine Afghanin kannte diese Maschine und zeigte, wie man sie so belädt, dass sie keine Unwucht kriegt, und dass man das Abwasser in einer Schüssel auffängt. Andächtig umstanden die anderen Frauen die rotierende Maschine und unterhielten sich. Alle kannten W-LAN. Eine Wäscheschleuder kannte niemand. Sie war so fremd wie ein Alien.
Natürlich wurden auch Wäscheständer gebraucht. Die ersten zehn Stück stellten wir überall in der Halle auf. Nach 10 Minuten waren sie weg. Nach 20 Minuten klopfte eine Frau an meine Bürotür und sagte, sie hätte auch gern einen Wäscheständer. Wir sammelten die Ständer ein und schraubten sie am Boden fest, so dass eine Art Wäscheplatz entstand. Nach kurzer Zeit waren sie Schrott, weil die Kinder damit spielten. Ein Wäscheständer ist halt nicht so stabil wie ein Klettergerüst.
Die neuen Ständer wurden neben den Betten-Kokons platziert. Nun war die Nutzergemeinschaft kleiner und musste sich einigen: Kann ich jetzt mal meine Wäsche…“
Seifenspender wurden an den Handwaschbecken aufgestellt und verschwanden sogleich. Irgendwann werden die Leute seifengesättigt sein, dachte Susanne. Das war ein Irrtum. Warum?
„Wenn du nicht darauf vertraust, dass dir Sachen zur Verfügung stehen, die du nicht besitzt, wirst du sie in deinen Besitz bringen, um sicher zu sein, dass du sie hast, wenn du sie brauchst. Außerdem wurde Seife zum Wäsche-Waschen verwendet. Unser Waschmittel schäumt nicht und war vielen Frauen deshalb suspekt.“
Jeden Morgen markierten große Wäschetüten im Flur die Position in der Reihe zur Wäscheabgabe. Wer zu spät kam, dessen Wäsche wurde nicht mehr angenommen, weil nur eine bestimmte Anzahl an Maschinenladungen pro Tag zu bewältigen war.
„Wir erklärten, stellten die Tüten zurück in die Halle, erklärten noch mal. Sinnlos!
Nach 60 Minuten Teamdiskussion sagte ein Mitarbeiter der Hauswirtschaft: ‚Ich nehme nicht nur neun Tüten Wäsche an. Ich nehme alles, was kommt. Das sind dann mal zehn, elf oder zwölf Tüten. Jeder beschwert sich, wenn ich seine Wäsche nicht annehme. Niemand beschwert sich, wenn sie abends noch nicht fertig ist.‘ Halleluja!“
Grenzen des Vergemeinschaftens
Vieles, das es in der Turnhallen-Zeit gab, sollte gemeinschaftlich genutzt werden: Spiele, Haarschneide- und Nähmaschinen, Musikinstrumente. Doch es war unrealistisch, all diese Sachen auszuleihen, und machte zu viel Arbeit. Merkte das Team, dass jemand oft Schach spielt, bekam er eins der Spiele.
Als eine junge moldawische Mutter ihren Rock flicken wollte, gab Susanne ihr blaues Garn und eine Nadel. Später brachte die Frau das Nähzeug zurück. Damit hatte Susanne nicht gerechnet.
„Ich habe mich geschämt. Das war doch absurd! Hier stieß das Vergemeinschaften an die Grenze der Würde. Wir haben dann Nähkästen besorgt und verteilt.
Manchmal haben wir Verhältnisse konstruiert wie Kinder, die sich draußen eine Räuberhöhle bauen oder Mutter-Vater-Kind spielen. Wir haben Verhältnisse geschaffen, die mal funktionierten und mal nicht. Wenn nicht, verwarfen wir unsere Idee und versuchten es anders. Mit unseren Plänen sind wir oft erst mal grandios gescheitert.“
Im Frühjahr fingen Leute an, draußen auf kleinen Kochern etwas zuzubereiten. Sie wollten endlich mal wieder was essen, das sie selbst gekocht hatten.
„Das war bedürfnisorientiert, selbstbestimmt und ein grundgesunder Impuls, fand ich. Also stellten wir draußen Tische mit Gaskochern auf, beschafften Töpfe und Geschirr aus den Spendenkammern und gingen einkaufen, damit alle, die das wollten, eine kleine Erstausstattung bekamen. Das war übrigens auch eine Form der Kommunikation für uns. Viele Leute sagten: ‚Catering ist Scheiße.‘ Egal, wie viel Mühe sich der Lieferant gab. Aber niemand hätte gefordert: ‚Baut hier mal eine Küche ein.‘
Wir versuchten, Dinge aufzugreifen, unsere eigenen Grenzen immer wieder in Frage zu stellen und neue Herausforderungen zu bewältigen. Aber: Wenn es Kocher und Kühlschränke gibt, muss jemand sie saubermachen. Doch in einer Turnhalle, in der alles frei zugänglich ist, funktionieren keine Reinigungspläne. Du musst jemanden bitten, dich zu unterstützen. Wenn du Glück hast, fühlt sich jemand berufen, langfristig Verantwortung zu übernehmen.
Rückblickend kann ich sagen: Das Ergebnis war nie so, wie ich es erwartet habe. Aber oft war es ziemlich interessant. So was nennt man wohl: neue Erfahrungen machen.“
Geschichten von Kindern
 In der Halle lebten zeitweise 100 Minderjährige. Es gab keine Kitaplätze und monatelang keine Schulplätze.
In der Halle lebten zeitweise 100 Minderjährige. Es gab keine Kitaplätze und monatelang keine Schulplätze.
Der Kinderraum in der Turnhalle war täglich geöffnet, und die Kinder wurden betreut. Anfangs bot ein Team-Mitglied Sprachunterricht für die älteren Kinder und Jugendlichen an.
„Dass es so lange dauerte, bis die Kinder zur Schule gehen konnten, fand ich fürchterlich. Für mich ist es ein hohes Gut, dass wir hier die allgemeine Schulpflicht für Mädchen und Jungen haben und sie umsetzen. Es trieb mir die Tränen in die Augen, dass ich für die Schulkinder der geflüchteten Familien nichts tun konnte.“
Die Kinder, vor allem die älteren, sprangen herum und wollten beschäftigt werden. Für sie war die Turnhalle ein großer Spielplatz, und…
„… es war immer was los. Die Erwachsenen konnten sich zurückziehen, zugucken oder mitmachen. Wenn wir Deko-Berge fürs nächste Fest mit den Kindern gebastelt hatten, war die Stimmung gut. Machten sich zwei Männer dran, die Deko-Elemente aufzuhängen – was in einer Turnhalle querdrüber nicht leicht ist –, war das ein Gewinn.
Zwar konnten sich die Kinder in der Halle frei bewegen, der Außenbereich war umzäunt, die Security passte auf, und selbst kleinere Kinder waren relativ sicher. Aber große Kindergruppen entwickeln im Spiel viel Dynamik, und dabei geht oft was zu Bruch. Gebetsmühlenartig wiederholte Reglementierungen halfen nicht. Irgendwann trugen wir zähneknirschend alle nicht benutzten Betten in den Keller, um gefährliche Kletteraktionen auf den instabilen Teilen zu verhindern.“
Hinter all diesen Erlebnissen und Entscheidungen stecken Prozesse – auf der Seite derjenigen, die die Verantwortung für die Turnhalle trugen, wie auf der Seite der Menschen, die darin lebten.
Feste feiern
„Das erste Fest war eine Abriss-Party, denn in der kleineren Halle, unserem Wohnzimmer, sollte PVC-Boden gelegt werden. Alles musste raus. Nach dem Abendessen wurden die Tische beiseitegestellt, die Musik-Anlange wurde aufgebaut, und wir legten los. Die ersten, die zur Musik rumsprangen, waren die jüngeren Kinder. Dann kamen die Männer dazu, schickten ihre eigene Musik von ihren Handys durch die Anlage und tanzten.“
Später nahm ein kleines Mädchen Susanne an die Hand und sagte: „Komm Dusche.“ Was wollte das Kind? Es brachte Susanne in den Duschraum der Frauen, die dort ihre Kopftücher abgelegt hatten und zu den Rhythmen aus einer kleinen Musikbox tanzten. „Komm rein“, bedeuteten sie Susanne. Danach wurde zu jeder Party ein Ort für die Frauen geschaffen – mal ein Zelt, mal etwas Anderes.
Von nun an gab es etwa alle acht Wochen ein Fest, entweder eine Tanzparty nach dem Abendessen oder große Feiern mit Programm und Gästen: mit Volontiergruppen, mit Ehrenamtlichen aus der Nachbarschaft, mit Freunden und Verwandten der Leute.
Nach dem Ramadan feierte man das Zuckerfest. Der Caterer grillte, es gab Zuckerwatte, Kuchen aus der benachbarten Schule, Musik und Spiele. Am Ende der Sommerferien fand ein Back-to-school-Fest mit Angeboten für die Kinder statt, und die Erwachsenen spielten mit. Zu Ostern wurden Eier gefärbt und Osternester versteckt. Zu Sankt Martin wurden Laternen gebastelt, Martinswecken geteilt, und zum Fasching gab es viele Prinzessinnen, Superhelden, Feuerwehrleute, Löwen und Tiger. Natürlich wurde auch Newroz gefeiert, das persische Neujahr.
„Als wir ein großes Weihnachtsfest planten, sagte jemand: ‚Weihnachten ist doch haram.‘ Okay. Wer nicht mitmachen will – bitte sehr! Ist ja jeder ein freier Mensch.“
 Vor dem Fest fragte Susanne Frauen, ob sie für so viele Leute kochen würden. Da sagte eine: „Ach, Susanne! Ich habe schon für 300 Leute gekocht…“ Sie zählte auf, was für das Festessen gebraucht wird, der Caterer lieh einen großen Topf aus, und die afghanischen Frauen kochten das Hauptgericht: Lamm mit roten Bohnen in grüner Kräutersoße. Die arabischen Frauen bereiteten Vorspeisen zu, die moldawischen machten einen Hühnerfleischsalat, und das Team kredenzte mit den Kindern Eisbomben als Dessert. Zwei Weihnachtsbäume mit selbst gebasteltem Schmuck und eine kleine Bühne standen in der Halle.
Vor dem Fest fragte Susanne Frauen, ob sie für so viele Leute kochen würden. Da sagte eine: „Ach, Susanne! Ich habe schon für 300 Leute gekocht…“ Sie zählte auf, was für das Festessen gebraucht wird, der Caterer lieh einen großen Topf aus, und die afghanischen Frauen kochten das Hauptgericht: Lamm mit roten Bohnen in grüner Kräutersoße. Die arabischen Frauen bereiteten Vorspeisen zu, die moldawischen machten einen Hühnerfleischsalat, und das Team kredenzte mit den Kindern Eisbomben als Dessert. Zwei Weihnachtsbäume mit selbst gebasteltem Schmuck und eine kleine Bühne standen in der Halle.
„Von einem heiß geliebten Bilderbuch aus meiner Kinderzeit hatten sich Kinder und Betreuerinnen inspirieren lassen und Szenen entwickelt: Wenn die Wolken sich im Dezember rosa färben, backen die Engel Kekse, lesen Wunschzettel, nähen Puppenkleidchen und packen alles ein. Bei uns gab es auch Geschenke, eine Weihnachtsfrau, Engel und einen Weihnachtself. Die coolsten Jungen zogen als Rentiere, mit Geweih und roter Blinke-Nase, den Schlitten.
Es war der Tag nach dem Terroranschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz. Wir waren uns einig: Weihnachten ist ein Fest des Friedens, und wir haben allen Grund, dieses Fest nicht ausfallen zu lassen, sondern zusammenzurücken.“
Am 5. Januar 2017 feierte das Gemeinwesen in der Turnhalle den 1. Geburtstag. Zwei Dutzend Geflüchtete waren seit Januar 2015 dabei. Was für eine Leistung!
Dann kam die letzte Fete, mit einer Bilder-Show per Beamer: Fotos aus der Turnhallen-Zeit, die am 21. März 2017 zu Ende ging, denn die Leute bekamen Plätze in anderen Unterkünften, die bessere Lebensbedingungen boten.
Der Auszug
Am ersten Tag zogen die allein reisenden Männer aus, am zweiten Tag die Familien. Für die Kinder und Familien hatte das Team zum Abschied Fotoalben vorbereitet.
Als die jungen Männer ausgezogen waren, saßen sie am späten Nachmittag wieder vor der Turnhalle und sagten: „In der neuen Unterkunft ist nix los.“ Warum? Kein W-LAN.
In den folgenden Tagen guckten die Kinder, die nahe der Turnhalle zur Schule gingen, beim Nach-Hause-Gehen vorbei, um zu sehen, wer noch da ist und wem sie helfen könnten.
Nach dem Auszug hatten sich Müllberge in der Halle aufgetürmt. Alle hatten das liegen gelassen, was sie nicht mitnehmen wollten. Wohin auch damit?
Niemand konnte sich mehr vorstellen, dass in dieser Halle Leute gelebt und gearbeitet, sich an- oder abgefreundet und Zeit miteinander verbracht hatten, die sie wahrscheinlich nicht vergessen.

Fazit
Mit den Leuten verständigte sich das zwölfköpfige „Kindererde“-Team auf Arabisch, Dari und Russisch, mit einigen auf Englisch, aber hauptsächlich per Pantomime. Erst später ging manches auf Deutsch.
„Es war eine unglaublich dichte, intensive Zeit, denn: Wenn du keine gemeinsame Sprache hast – Worte schaffen ja immer auch Distanz – und mehr mit deinem Körper sprichst, dann ist das deutlich weniger distanziert und emotional aufgeladener.
Ich hatte mal versucht, das den Leuten zu erklären: Ist jemand berührt oder traurig, kann ich ihn in den Arm nehmen. Verbietet sich das, zum Beispiel weil ein Mann vor mir steht, kann ich mein Mitgefühl ausdrücken, indem ich meine Hände auf die Brust lege. Ich habe nur meinen Körper und meine Mimik. Gebrauche ich sie, löst das etwas aus. Bei mir und bei dem anderen Menschen. Es macht etwas mit uns.“
Als alles begann, legte das Team los, fummelte sich ein, und im Verlaufe eines Jahres entwickelte sich tatsächlich eine Art Gemeinwesen:
„Die Art und Weise, in der wir die Dinge angingen, stärkte besonders die Frauen. Viele von ihnen bewegten sich frei und unbefangen, kochten, diskutierten über Rezepte und tranken zusammen Tee. Die allein reisenden Männer – alle ja auch Söhne, Brüder oder Ehemänner –respektierten die weiblichen Räume.“
Eigentlich haben alle Beteiligten – die Leute und das Team – das Gleiche getan: ein Gemeinwesen aufgebaut. Die einen haben ihre „Häuser“ hergerichtet, die anderen waren für die öffentlichen Einrichtungen zuständig: Rathaus (Büro), Wäscherei, Badehaus, Kinderraum und Spielplatz, Läden des täglichen Bedarfs (Hygieneausgabe und Kleiderkammer), Restaurant, Café, Kino und die Arztpraxis.
„Das Verrückte war: Wir hatten gar keine gemeinsame Perspektive. Weder war es das Lebensideal irgendeiner anwesenden Person, in einer Turnhalle zu leben, noch wussten wir, mein Team und ich, wie lange das eigentlich dauern soll…
Und – machen wir uns nichts vor: Das waren Lebens- und Arbeitsbedingungen, die nicht alle Menschen aushalten können, weder Geflüchtete noch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter.“
+ + +
Susanne Hantz und ihr Team haben das ausgehalten. Mir hat Susanne davon erzählt. Ich weiß nicht, ob ich es ausgehalten hätte. Aber ich beneide Susanne um diese Erfahrung und hoffe, dass ich aus dem, was sie erzählte, etwas gelernt habe. Danke, Susanne.
Fotos: Kindererde gGmbH

 In den nächsten Wochen hörte Susanne nichts mehr von der Doppelturnhalle, bekam aber zahlreiche Anrufe und Mails mit anderen Angeboten. Doch nach dem Vor-Ort-Besuch hatte das „Kindererde“-Team sich geeinigt: Wir sind bereit, aber wir übernehmen keine einräumige Halle.
In den nächsten Wochen hörte Susanne nichts mehr von der Doppelturnhalle, bekam aber zahlreiche Anrufe und Mails mit anderen Angeboten. Doch nach dem Vor-Ort-Besuch hatte das „Kindererde“-Team sich geeinigt: Wir sind bereit, aber wir übernehmen keine einräumige Halle.
 In der Halle lebten zeitweise 100 Minderjährige. Es gab keine Kitaplätze und monatelang keine Schulplätze.
In der Halle lebten zeitweise 100 Minderjährige. Es gab keine Kitaplätze und monatelang keine Schulplätze. Vor dem Fest fragte Susanne Frauen, ob sie für so viele Leute kochen würden. Da sagte eine: „Ach, Susanne! Ich habe schon für 300 Leute gekocht…“ Sie zählte auf, was für das Festessen gebraucht wird, der Caterer lieh einen großen Topf aus, und die afghanischen Frauen kochten das Hauptgericht: Lamm mit roten Bohnen in grüner Kräutersoße. Die arabischen Frauen bereiteten Vorspeisen zu, die moldawischen machten einen Hühnerfleischsalat, und das Team kredenzte mit den Kindern Eisbomben als Dessert. Zwei Weihnachtsbäume mit selbst gebasteltem Schmuck und eine kleine Bühne standen in der Halle.
Vor dem Fest fragte Susanne Frauen, ob sie für so viele Leute kochen würden. Da sagte eine: „Ach, Susanne! Ich habe schon für 300 Leute gekocht…“ Sie zählte auf, was für das Festessen gebraucht wird, der Caterer lieh einen großen Topf aus, und die afghanischen Frauen kochten das Hauptgericht: Lamm mit roten Bohnen in grüner Kräutersoße. Die arabischen Frauen bereiteten Vorspeisen zu, die moldawischen machten einen Hühnerfleischsalat, und das Team kredenzte mit den Kindern Eisbomben als Dessert. Zwei Weihnachtsbäume mit selbst gebasteltem Schmuck und eine kleine Bühne standen in der Halle.
 Eine junge Syrerin hatte während ihres Studiums in Damaskus ein Praktikum in einer Kita absolviert. In Damaskus, wohlgemerkt. Vor zwei Jahren war sie geflüchtet, begleitet nun eine Fortbildnerin hin und wieder bei deren Aktivitäten im brandenburgischen Arbeitskreis „Mehrsprachigkeit“ und berichtet den Teilnehmerinnen, dass es in Syrien ein Schulsystem und Vorschul-Kitas gab. Dafür waren ihr die hiesigen Erzieherinnen dankbar, denn sie können sich jetzt erklären, was sie erleben: Etliche syrische Eltern aus den Flüchtlingsunterkünften bringen ihre Kinder mit gepackten Ranzen in die Kitas, weil sie davon ausgehen, dass die Kinder in der Kita schreiben und lesen lernen. Bekommen die Eltern mit, dass das nicht so ist, beschweren sie sich.
Eine junge Syrerin hatte während ihres Studiums in Damaskus ein Praktikum in einer Kita absolviert. In Damaskus, wohlgemerkt. Vor zwei Jahren war sie geflüchtet, begleitet nun eine Fortbildnerin hin und wieder bei deren Aktivitäten im brandenburgischen Arbeitskreis „Mehrsprachigkeit“ und berichtet den Teilnehmerinnen, dass es in Syrien ein Schulsystem und Vorschul-Kitas gab. Dafür waren ihr die hiesigen Erzieherinnen dankbar, denn sie können sich jetzt erklären, was sie erleben: Etliche syrische Eltern aus den Flüchtlingsunterkünften bringen ihre Kinder mit gepackten Ranzen in die Kitas, weil sie davon ausgehen, dass die Kinder in der Kita schreiben und lesen lernen. Bekommen die Eltern mit, dass das nicht so ist, beschweren sie sich.