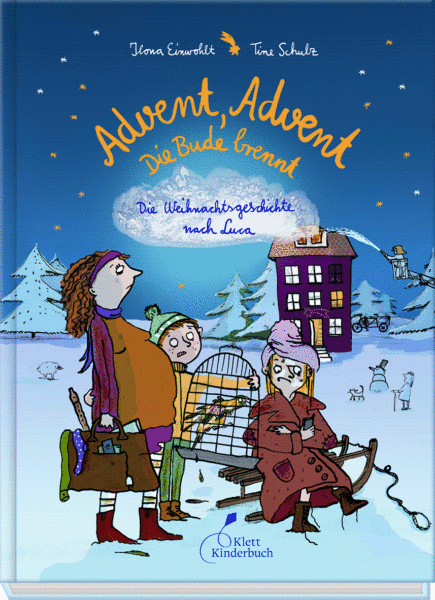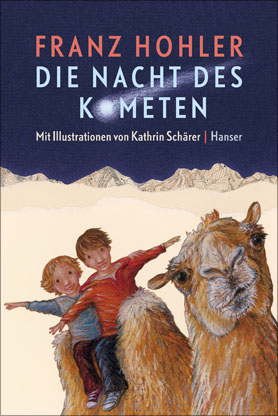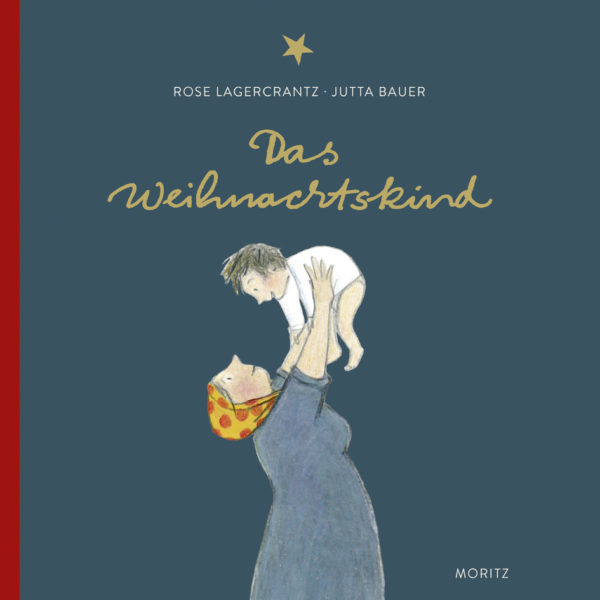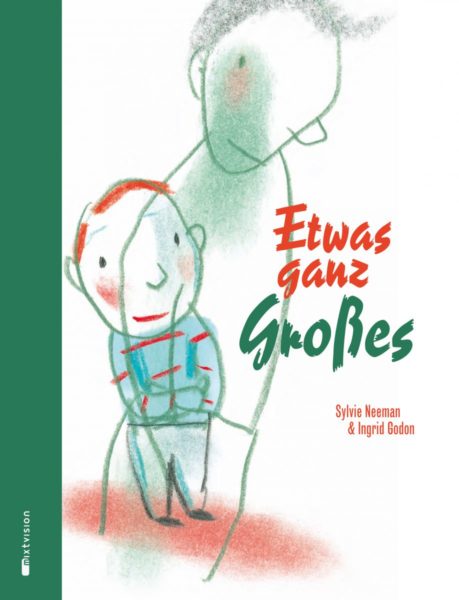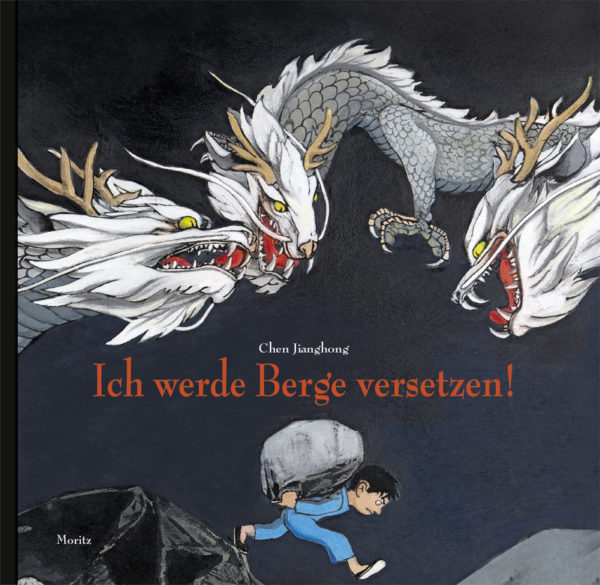Ich begann mein Lehramtsstudium hauptsächlich, weil ich als Lehrer etwas anders machen wollte. Ich wusste nicht so genau was, aber irgendetwas musste wohl in meiner Schulzeit gründlich schief gelaufen sein. Ich hätte ja vielleicht ADHS gehabt, aber das gab’s damals noch nicht, wir mussten ja mit so wenig auskommen. Ein kleiner Teil von mir wusste zwar noch, dass ich nicht so falsch sein konnte, wie mir die Schule immer weismachen wollte, aber ein größerer Teil fühlte sich immer unwohl in meiner Haut.
Meine Dozenten bemängelten dann in meinen Studienpraktika meine „kumpelhafte“ Haltung den Kindern gegenüber. Ich wollte ihnen damit zeigen, dass ich auf ihrer Seite stehe. Meine naive Theorie war, dass man nur netter zu den Kindern sein müsste, dann würden sie sich auch schon nach Lehrerwunsch verhalten. Da hielt ich Schule noch für etwas grundsätzlich Wünschenswertes. Das änderte sich dann, als ich Literatur zu anarchistischen Schulversuchen der Vergangenheit in die Hände bekam. Auch die Entschulungsdiskussion der 70er und 80er lebte ich mit Ivan Illich und Everett Reimer in abgegriffenen rororo- Bänden noch einmal nach. Ich lernte eine ganze Reihe Freier Schulen kennen und schloss mit mir folgenden Kompromiss: Wenn schon Schule, dann mit ganz viel Freiheit und Gleichberechtigung, eben liberté und egalité und über kurz oder lang würde sich dann auch die fraternité über einer Tasse Kamillenté einstellen.
An meiner ersten Stelle – einer freier Schule im Aufbau – hatte ich schon ein wenig Gelegenheit, meine neuen Ideen einzubringen. Und ich konnte mich prima gegen meine Kollegen abgrenzen, diese bourgeouisen Reaktionäre! Als die Kinder dann mal im von mir installierten Kinderrat vorhatten, Verstöße durch eine Art Prangersystem im Käfig zu ahnden, musste ich leider eingreifen. Bevor aber mein Weltbild wanken konnte, hatte ich natürlich schon eine Erklärung parat: Die armen Kinder waren natürlich durch ihre bisherige Schulkarriere – alle waren vorher schon auf anderen Schulen gewesen – verdorben. Die unnatürliche, patriarchale Erziehung der Eltern tat ihr Übriges. So dachte ich wirklich, wenn mir auch viele Denkstrukturen erst im Nachhinein bewusst wurden.

Dann aber kam meine Chance: Nach dieser Stelle durfte ich eine Schule mitgründen und von Anfang an die Bedingungen schaffen, in der sich Kinder in Freiheit normalisieren. Ich musste nur die Ketten der kapitalistischen Verwertungsmaschine von ihnen nehmen und sie würden lernen und sich vertragen und eine neue Rasse von Homo sapiens sapiens sapiens bilden. Nietzsches Übermensch schien zum Greifen nah. Während ich natürlich ein wenig übertreibe, war ich doch wirklich überzeugt, dass Demokratie der entscheidende Faktor des Bildungserfolges dieser Kinder war. Zum Glück ist Realität die härteste Wand, gegen die man laufen kann. Die Kinder erzogen mich wirklich prima. Ich weiß nicht, welche Maßeinheit für den Verschleiß von Nerven angewandt wird, aber ich habe ordentlich Federn gelassen.
Eine Weile nach meinem Ausscheiden aus der Schule begann es dann aber auch mir zu dämmern, was Jesper Juul so treffend in seinen Büchern schreibt: Demokratie beschreibt eine Methodensammlung zur Entscheidungsfindung, nicht mehr und nicht weniger. Sie ist als Bezugssystem zwischen Menschen ungeeignet. Man kann keine demokratische Beziehung zueinander haben. Beziehungen können gut sein oder schlecht, liebevoll oder kalt, zärtlich oder grob.
In der Beziehung liegt der Gestaltungsspielraum des Pädagogen. Aber einfach netter, so wie ich mal vor Jahren dachte, reicht einfach nicht. Man muss umfassend und bewusst eine Beziehung aufbauen, die das Kind genau in seiner Bedürfnislage sieht und unterstützt. Das kann auch bedeuten, dass man gar nicht nett ist und deutliche Worte finden muss, wenn ein Kind Orientierung sucht. Für mich war gerade das sehr schwer, da ich oft Schelte von meinen Lehrern aushalten musste. Es hat mich viel Arbeit an mir gekostet, zu verstehen, dass man sich persönlich abgrenzen kann, ohne einen anderen zu begrenzen.
Zu guter Letzt will ich aber doch noch der Demokratie eine Lanze brechen. Wenn man einmal den Boden der Beziehung vorbereitet hat und der gegenseitige Respekt gegeben ist, dann ist Demokratie das schönste Sahnehäubchen, dass man sich auf seinen Schwarzwaldbecher tun kann. Und je direkter sie ist, desto mehr Kirschen kommen noch drauf. Und die Schokostreusel der Herrschaftsfreiheit erst… mmmh! Guten Appetit!
Foto: Lena Grüber